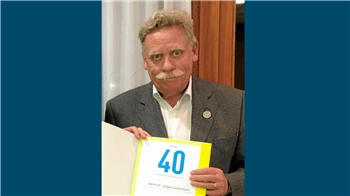Nicht jedes Wohnhaus in Deutschland ist fit für die Energiewende

Ein Solarpark soll auf einer Fläche von 26 Hektar östlich des Zollbaums zwischen Brucher Schleusenfleth und Neuenwegfleth entstehen.
Die Energiekrise verändert viel: Häuslebauer und -besitzer bauen anders und bauen um. Viele Online-Programme zeigen den Verbrauchern, für wen der Einbau von einer Wärmepumpe oder Solaranlage möglich ist – und für wen es sich nicht empfehlen lässt.
Regenerative Energieträger stehen bei Häuslebauern und -sanierern derzeit hoch im Kurs. Doch das Thema ist komplex. Um zu prüfen, ob Wohnhäuser für den Einbau von Wärmepumpe oder Fotovoltaik-Anlage überhaupt geeignet sind, gibt es spezielle Werkzeuge im Internet. Ein Überblick.
Wärmepumpen-Ampel
Die Einsatzmöglichkeiten von Wärmepumpen hängen stark von lokalen Faktoren ab – etwa davon, ob der Platz im eigenen Garten ausreicht, um eine solche Pumpe einzubauen. Zudem stellen sich die Fragen: Welche Pumpen-Variante kommt für mein Haus infrage und welche Wärmequelle ist besser geeignet, um mein Haus zu beheizen: Luft, Erde oder Sonne?
Um Hauseigentümerinnen und -eigentümern eine erste Orientierung zu bieten, entwickelte die Forschungsstelle für Energiewirtschaft (FfE) in München die „Wärmepumpen-Ampel“. Diese untersucht deutschlandweit mittels einer interaktiven Karte die Eignung der Technologien zur Versorgung eines Gebäudes.
Das Potenzial für mindestens eine der Wärmepumpen-Technologien in Wohngebäuden liegt laut FfE bei 75 Prozent. Verbaut seien demnach aktuell rund eine Million Pumpen. Das entspricht fünf Prozent der 19 Millionen Wohngebäude. Die Bundesregierung plant mit sechs Millionen Wärmepumpen bis zum Jahr 2030.
Für die Umsetzung der „Wärmepumpen-Ampel“ analysierte die FfE etwa 17 Millionen Wohngebäude in Deutschland. Das Ergebnis: In 65 Prozent der Gebäude könnte eine Luft-Wärmepumpe eingebaut werden. Die Erdsonden-Wärmepumpe kommt den Angaben zufolge für 47 Prozent infrage. 24 Prozent könnten mithilfe einer Erdkollektor-Wärmepumpe ihre Gebäude heizen. Die vierte Variante, die Solar-Eisspeicher-Wärmepumpe, wäre für 37 Prozent der analysierten Gebäude eine Option. Mitunter stehen für Wohnhäuser auch mehrere der Technologien zur Auswahl.
In einem Feld auf der Webseite www.wärmepumpen-ampel.de trägt man zunächst seine Postleitzahl ein. Dann öffnet sich der Ort auf einer interaktiven Karte. Diese ist beweglich und kann verschoben werden. Eine Legende, die leider teilweise die freie Sicht auf die Karte verhindert, zeigt anhand der Ampel-Farben, welches Gebäude für welche Variante geeignet ist.
Ist das Haus grün, ist es „für mindestens eine Wärmepumpen-Technologie wahrscheinlich geeignet“. Gelb heißt, das Haus ist „für mindestens eine Wärmepumpen-Technologie gegebenenfalls geeignet“. Ist das Haus gelb oder grün, verrät ein Klick auf das Gebäude, welche Pumpen-Varianten für den Einbau infrage kommen.
Ist das Eigenheim rot hinterlegt, kommen die verschiedenen Technologien eher nicht infrage. Bei einem Klick aufs Gebäude erscheint allerdings der Hinweis, dass sich eine Experten-Einschätzung lohnen könnte. „Die Ergebnisse basieren auf Modellen und können in keinem Fall eine Fachberatung ersetzen“, so die FfE.
Probleme gibt es auf der interaktiven Karte mit Doppel-, Reihen und Mehrfamilienhäusern, die oft nicht berücksichtigt sind. Die FfE nennt hierfür mehrere Gründe, unter anderem verfälschte Abstände durch digitale Landkarten.
Das Solarkataster
Bei der Energiewende spielt auch die Sonne eine große Rolle. Doch nicht immer ist eine Stromgewinnung über die eigene Dachfläche ratsam. Ein Online-Atlas zur Ermittlung des Solarpotenzials soll hier Abhilfe schaffen: Auf der Webseite www.solarenergie.de erhalten Nutzer eine Übersicht über Solarkataster von Städten und Kommunen. Per Link gelangt man zu den jeweiligen Bundesländern, die ein elektronisches Solarkataster führen.
Die Kataster zeigen Landkarten, in denen die vorhandene Bebauung zu sehen ist. Durch unterschiedliche Farben, von Rot für sehr gut bis Blau für ungeeignet, wird angezeigt, welche Voraussetzung das Dach für die solare Stromgewinnung mitbringt.
Wer die Dachfläche seines eigenen Hauses untersuchen will, muss zunächst die Adresse eingeben. Da der Solaratlas nach Norden ausgerichtet ist, sehen Nutzer auf einen Blick, ob das Gebäude von der Sonneneinstrahlung profitieren kann. Je nach Bundesland gibt es mit einem weiteren Klick auf ein Gebäude etwa Informationen zu Sonneneinstrahlungskategorie, Stromverbrauch, Strompreis oder auch Stromertrag durch eine Photovoltaik-Anlage. Aufgezeigt wird zum Teil auch, inwieweit eine Installation von Solarthermie-Anlagen für die Warmwasser-Erzeugung möglich ist.
Grundlage für das Angebot bilden Vermessungsdaten der Kommunen oder von Interessengemeinschaften erstellte Auskunftssysteme, berichtet Kerstin Reimann auf solarenergie.de. 30 bis 35 Grad Neigungswinkel und eine Dachausrichtung nach Süden sollen die idealen Voraussetzungen für die Solarstrom-Gewinnung bieten. Aber: „Auch nicht ideal ausgerichtete Photovoltaik-Anlagen können die Energie der Sonneneinstrahlung effizient nutzen“, so Reimann.