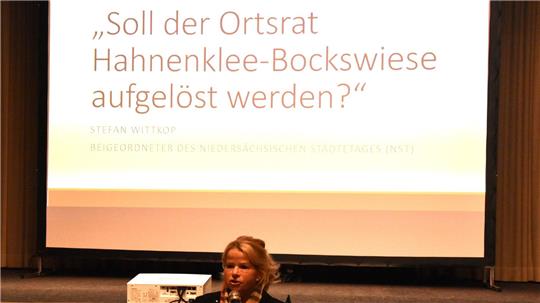Verkehrsgerichtstag in Goslar: Das wird diskutiert

Ein Teilnehmer bei einen Fahrsicherheitstraining für Senioren fährt über eine Teststrecke. Muss ein Arzt Personen, die er nicht für fahrtauglich hält, an die Behörden melden? Unter anderem mit dieser Frage beschäftigen sich Experten beim Verkehrsgerichtstag. Foto: Wolfram Kastl/dpa
Muss ein Arzt Personen, die er nicht für fahrtauglich hält, an die Behörden melden? Das und Themen wie die Haftung bei Unfällen mit KI-gesteuerten Autos und Alkoholfahrten auf Elektro-Tretrollern beschäftigen Experten beim Verkehrsgerichtstag.
Am Donnerstag startet der 61. Deutsche Verkehrsgerichtstag (VGT). Er zählt zu den wichtigsten Treffen von Fachleuten für Verkehrssicherheit und -recht in Deutschland. Wieder werden rund 2000 Experten erwartet, die am Ende des Kongresses Empfehlungen an den Gesetzgeber aussprechen. Acht Arbeitskreise widmen sich aktuellen und kontroversen Themen – unter anderem die „Halterhaftung bei Verkehrsverstößen“, die Promillegrenze, die bei der Fahrt mit kleinen Elektro-Rollern gelten sollte, und die Meldepflicht von fahrungeeigneten Personen durch Ärzte. Die Experten diskutieren auch darüber, ob deutsche Haftungs- und Versicherungsregelungen im Straßenverkehr ausreichend für das Aufkommen von autonomen und von künstlicher Intelligenz gesteuerten Autos sind.
Meldepflicht bei mangelnder Fahrtauglichkeit? Verbände sind dagegen
Muss ein Arzt Personen, die er nicht für fahrtauglich hält, an die Behörden melden?
Automobilverbände haben sich gegen eine Meldepflicht von fahrungeeigneten Personen durch Ärzte ausgesprochen. Es gebe bereits in Ausnahmefällen Möglichkeiten für Ärzte, Hinweise an Fahrerlaubnisbehörden weiterzugeben, teilte etwa der Automobilclub von Deutschland (AVD) vor dem Verkehrsgerichtstag mit, bei dem das Thema besprochen wird. Der AVD betonte, dass es sich um ein sensibles Thema handele, „das in einer alternden Gesellschaft an Relevanz gewinnt“.
Der Automobilclub ist somit gegen eine Änderung der bisherigen Rechtspraxis. Er befürwortete allerdings die Förderung regelmäßiger freiwilliger Seh- und Reaktionstests oder auch PKW-Sicherheitstrainings. Deren Ergebnisse müssten allerdings vertraulich bleiben, teilte der AVD mit.
„Gefahr in Verzug“ – Meldung auch jetzt schon möglich
Ohnehin hätten Ärztinnen und Ärzte bereits die Möglichkeit, fahrungeeignete Personen den Behörden zu melden, wenn sie „Gefahr in Verzug“ feststellen. Der AVD bezieht sich dabei auf ein Urteil des Bundesgerichtshofes aus dem Jahr 1968. Demnach dürfen Ärzte in Ausnahmefällen die Schweigepflicht brechen. Dazu müssen sie zuerst den Patienten über seine Erkrankung und die damit verbundenen Gefahren des Autofahrens aufklären.
Untersuchungen zeigten zudem, dass viele ältere Autofahrer und Autofahrerinnen in der Lage seien, auftretende Leistungseinbußen auszugleichen – etwa durch vorsichtigeres Fahren oder Verzicht auf das Fahren bei Dunkelheit oder schlechtem Wetter. „Es überrascht daher nicht, dass Senioren nach der Statistik am Verkehrsunfallgeschehen unterproportional beteiligt sind“, hieß es.
ADAC: Meldepflicht schadet Vertrauensverhältnis
Der Allgemeine Deutsche Automobilclub (ADAC) befürchtet, dass eine Meldepflicht das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patienten stark gefährde und im Zweifel dazu führe, „dass diese eine behandlungsbedürftige Beeinträchtigung aus Angst vor dem Führerscheinverlust nicht offen schildern“. Zudem gibt der ADAC zu bedenken, dass nicht jeder Befund eindeutig mit Blick auf die Fahreignung sei. Er plädiert deshalb für die Schaffung einer Stelle für verkehrsmedizinische Fragestellungen, bei der sich Patienten eine zweite Meinung einholen können.
Auch die Knüpfung der Fahrerlaubnis an regelmäßige Untersuchungen lehnt der Automobilclub ab. „Was sollte dabei geprüft werden? Hör- und Sehtests würden nicht ausreichen“, sagte der Leiter der juristischen Zentrale beim ADAC, Markus Schäpe. Es müssten weitere Eigenschaften wie Konzentrationsvermögen oder Reaktionsgeschwindigkeit komplex untersucht werden. Zudem seien etwa in Italien, wo es ein derartiges System gibt, Senioren nicht weniger an Unfällen beteiligt als in Deutschland.
Unfallforscher: Beratungsstelle für Ärzte anbieten
Der Münchener Rechtsanwalt Michael Pießkalla, der zu dem Thema in Goslar referieren wird, meint, es sei schwer zu beurteilen, ab wann eine Meldepflicht gelten solle. „Letztlich kann es meines Erachtens nicht dem Ermessen des Arztes überlassen bleiben, welche Krankheitsbilder er meldet“, sagte er.
Unfallforscher Siegfried Brockmann vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft sprach sich für eine Beratungsstelle aus, die Ärzte im konkreten Fall zur Seite stünde. Eine solche Stelle könne bei Ärztekammern angesiedelt werden.

Ein ohne Fahrer fahrender Kleinbus der Hamburger Hochbahn fährt durch die HafenCity. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa
Ein weiteres Thema, das von den Fachleuten in einem Arbeitskreis diskutiert werden wird, ist das Haftungsrecht für autonome Fahrzeuge – und ob es angepasst werden muss. Dahinter steht die Frage, wer im konkreten Fall für einen Schaden aufkommt, wenn bei einem Unfall nicht ein Mensch, sondern eine künstliche Intelligenz das Auto gesteuert hat. Automobilverbände haben vor dem Verkehrsgerichtstag eine Beibehaltung des Haftungsrechtes für autonome Fahrzeuge gefordert.
Automobilverbände wollen Beibehaltung des Haftungsrechts für KI-Autos
Die bisherige Regelung sei für moderne Mobilitätsformen mit Künstlicher Intelligenz (KI) ausreichend. Unter anderem der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) und der Automobilclub von Deutschland sind dafür, das bisherige Haftungssystem beizubehalten.
In Deutschland ist es bisher Pflicht, dass der Halter eines angemeldeten Fahrzeuges den Wagen mindestens Haftpflicht versichert hat. „So ist sichergestellt, dass der Geschädigte sich direkt an die Versicherung des hochautomatisierten oder autonomen Fahrzeugs wenden kann und seinen Schaden ersetzt bekommt“, teilte der ADAC mit.
„Fit für das autonome Fahren“
Auch der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) erklärte: „Das nationale Verkehrshaftungsrecht ist fit für das autonome Fahren mit Künstlicher Intelligenz.“ Die bisherige Regelung habe Vorteile für alle Verkehrsteilnehmer und trage zur gesellschaftlichen Akzeptanz autonomer Fahrzeuge und Künstlicher Intelligenz bei. Die Regelung verhindere zudem wirksam, dass sich Fahrer, Halter und Hersteller zulasten der unschuldigen Verkehrsopfer gegenseitig die Schuld zuschieben.
Debatte auch auf EU-Ebene
In Deutschland wurde 2021 ein Gesetz beschlossen, das den Rechtsrahmen für autonome Fahrzeuge festsetzen soll. Bei bestimmten Fahrzeugen dürfen sich Fahrer vom eigentlichen Fahrvorgang abwenden und müssen lediglich wahrnehmungsbereit bleiben – dürfen also nicht einschlafen, erklärte ein Sprecher des Deutschen Anwaltvereins. „Wirklich vollautonome und damit fahrerlose Fahrzeuge dürfen derzeit nur in räumlich festgelegten Grenzen verwendet werden.“ Auch auf Ebene der Europäischen Union wird derzeit über Haftungsfragen von autonomen Fahrzeugen debattiert.
„Es ist nicht mehr der Nutzer, sondern der Hersteller, der das "Verhalten" seiner Produkte auch noch nach ihrem Inverkehrbringen bestimmt“, sagte der Rechtswissenschaftler Gerhard Wagner von der Humboldt-Universität zu Berlin.

Kurios geparkt: Ein E-Scooter hängt an einem Schornstein. Fachleute und Verbände haben vor dem Verkehrsgerichtstag eine Anpassung der Promillegrenze für E-Scooter-Fahrer gefordert. Foto: Julian Stratenschulte/dpa
In vielen Städten gehören sie mittlerweile zum Stadtbild, beim Verkehrsgerichtstag sind sie auch Thema: Die oft grün lackierten Elektro-Roller zum Mieten. Die Roller werden häufig an den kuriosesten Orten abgestellt; in Gebüschen, auf Dächern von Bushaltestellen, manchmal auch in Gärten – das führte zuvor schon zu Kritik. Doch die Parksituation der kleinen Fahrzeuge ist nicht das Thema, über das die Experten beraten.
Fachleute und Verbände haben eine Anpassung der Promillegrenze für E-Scooter-Fahrer gefordert. Bisher orientiert sich der Wert an dem für Autos. Einige Experten fänden eine Anlehnung an den weniger strengen Grenzwert für Fahrräder passender.
Höchstens 20 km/h schnell
E-Scooter würden höchstens 20 Kilometer pro Stunde schnell fahren. Damit seien sie dem Fahrrad näher als einem Auto, teilte der Allgemeine Deutsche Automobilclub (ADAC) mit. Auch gesetzlich seien E-Scooter dem Zweirad näher: „So existieren weder Helmpflicht noch eine Fahrerlaubnispflicht.“ Es stelle sich daher die Frage, warum bei der Promillegrenze eine Unterscheidung gemacht werde. Der ADAC regt eine Klarstellung durch den Gesetzgeber an. Künftig solle bei der rechtlichen Bewertung besser zwischen führerscheinpflichtigen und führerscheinfreien Fahrzeugen unterschieden werden – statt zwischen Kraftfahrzeugen und anderen Fahrzeugen.
Bisher: Ab 0,5 Promille eine Ordnungswidrigkeit
Bisher ist das Fahren von Fahrrad oder E-Bike unter Alkoholeinfluss bis 1,6 Promille straffrei, solange der Fahrer oder die Fahrerin keine Ausfallerscheinungen habe und es zu keinem Unfall komme, erklärte Unfallforscher Siegfried Brockmann vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). E-Scooter gelten aber als Kraftfahrzeuge und werden wie Autos behandelt. Das bedeutet: Bei einer Fahrt mit 0,5 Promille oder mehr begeht der Fahrer eine Ordnungswidrigkeit. Eine Geldbuße von 500 Euro und ein Monat Fahrverbot sind dann möglich. Ab 1,1 Promille sind – selbst ohne Ausfallerscheinungen – auch höhere Geldstrafen und der Entzug der Fahrerlaubnis möglich. Autofahrer dürfen dann erst nach einer medizinisch-psychologischen Untersuchung wieder hinter das Steuer.
E-Scooter sei weit weniger gefährlich
„Aus Sicht des ADAC sollte die Teilnahme am Straßenverkehr und der Alkoholkonsum immer strikt getrennt werden“, betonte der Automobilclub. Es müsse aber berücksichtigt werden, wenn Menschen nach dem Alkoholkonsum auf das Auto verzichten und stattdessen den „weit weniger gefährlichen E-Scooter“ nutzen. Das sieht auch Unfallforscher Brockmann so. Er regt an, in einer Studie zu untersuchen, ab welchem Blutalkoholwert eine absolute Fahruntüchtigkeit bei E-Scooter-Fahrern angenommen werden kann.
Die Zahl der Verkehrsunfälle mit E-Scootern ist in Niedersachsen zuletzt deutlich gestiegen. Im Jahr 2021 gab es in dem Bundesland 634 Unfälle mit den Elektrorollern, wie das zuständige Innenministerium Anfang Januar mitteilte. Ein Jahr zuvor lag die Zahl demnach noch bei 295. Auch die Zahl der Trunkenheitsfahrten, die zu Verkehrsunfällen führten, ist den Angaben zufolge gestiegen.
Prüfung für die E-Tretroller-Fahrerlaubnis
Der Automobilclub von Deutschland plädiert dafür, alkoholisierten E-Scooter-Fahrern ab einem Blutalkoholwert von 1,1 Promille die Erlaubnis zum Fahren von elektrischen Tretrollern zu entziehen, falls der oder die Betroffene keinen Autoführerschein besitzt. Darüber hinaus sollten E-Scooter-Fahrer ähnlich wie Mofa-Fahrer in einer theoretischen Prüfung Straßenverkehrskenntnisse nachweisen müssen. Auch eine Helmpflicht für Fahrzeuge, die schneller als sechs Kilometer pro Stunde fahren können, sei denkbar.
Unfälle
Bundesweit ist die Zahl der E-Scooter-Unfälle mit Verletzten in 2021 gegenüber dem Vorjahr um 156,8 Prozent gestiegen, wie aus Zahlen hervorgeht, die der GDV veröffentlicht hat. Von 325.961 Verunglückten waren demnach 1,7 Prozent in 2021 E-Scooter-Fahrer. In knapp 90 Prozent der Unfälle, in denen eine Fahruntüchtigkeit bei dem E-Rollerfahrer festgestellt wurde, war er alkoholisiert. Daten aus der norwegischen Hauptstadt Oslo zeigten zuletzt, dass sich Unfälle mit E-Scootern meist nachts oder abends durch betrunkene Fahrer ereignen.
Reaktionstest per App?
Aus polizeilicher Sicht sei es wichtig, dass es zu einer einheitlichen Rechtsauslegung komme. Ein Beamter der Polizei Hannover nimmt in Goslar an dem Arbeitskreis zu der E-Scooter-Thematik als Referent teil. So könne es zu einer einheitlichen polizeilichen Vorgehensweise kommen und Regeln sowie Folgen eines Regelverstoßes den Fahrern transparent vermittelt werden. Das würde zu einer Erhöhung der Verkehrssicherheit führen.
Der Automobilclub Verkehr (ACV) wünscht sich von den Anbietern der Elektroroller mehr Bemühungen bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit der Fahrer. „Etwa in Form von Reaktionstests mit Hilfe einer App“, teilte der ACV mit.
Bundeseinheitliche Regelung
Auch bei sehr hohen Alkoholkonzentrationen könne man die Fahrer nicht mit denen von Pkw oder gar Lkw vergleichen, sagte Rechtsanwältin Heike Becker vom Deutschen Anwaltverein (DAV). E-Scooter-Fahrer seien eher mit denen von E-Bikes zu vergleichen. Sie fordert deshalb eine Anhebung der Promillegrenze auf 1,6. Vor allem brauche es aber eine bundeseinheitliche Regelung.