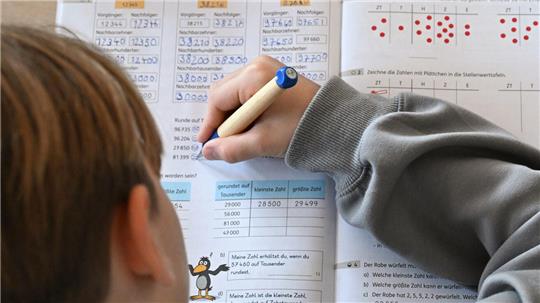Wann bekommt Niedersachsen eigene Löschflugzeuge?

Ein Flugzeug vom Typ Dromader PZL M18 B hilft bei großen Waldbränden im Harz. Der Landkreis Harz hat sich die Dienste eines solchen Löschfliegers gesichert. Foto: Deutsche Löschflugzeug- Rettungsstaffel
Niedersachsen wartet auf Löschflugzeuge. Das Innenministerium in Hannover verweist auf noch fehlende EU-Zusagen. In Sachsen-Anhalt ist man weiter: Dort ist das erste Flugzeug des Typs PZL M-18 Dromader seit wenigen Wochen bereits einsatzbereit.
Hannover. Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens hat von ihrem Vorgänger Boris Pistorius (beide SPD) eine Reihe politischer Projekte geerbt. Darunter auch die finale Umsetzung der Anschaffung zweier Löschflugzeuge. Diese sollen künftig Feuerwehrkräfte am Boden bei extremen Waldbrandlagen aus der Luft unterstützen. Wie im Harz im vergangenen Jahr, als mehrere Großbrände in kurzen Abständen ausbrachen.
Hier waren über Tage nicht nur Hubschrauber von Bundespolizei und Bundeswehr an den Löscharbeiten beteiligt, sondern auch eine Fliegerstaffel aus Italien. Eine Erkenntnis, die das Land aus der geleisteten europäischen Nothilfe zog: Künftig wolle man flexibler und eigenständiger agieren können.
Nach der Ankündigung von Pistorius, der im Januar an die Spitze des Bundesverteidigungsministeriums gewechselt war, lässt die Anmietung der Flugzeuge unter Behrens jedoch weiter auf sich warten. Ministeriumssprecherin Svenja Mischel verweist in dem Zusammenhang auf die Europäische Union, die ein vor drei Monaten zu Ende gegangenes Bewerbungsverfahren noch nicht abgeschlossen habe. „Insofern können zum jetzigen Zeitpunkt auch weiterhin keine näheren Aussagen zu Löschflugzeugtyp, Auftragnehmer oder den Stationierungsflugplätzen getroffen werden“, teilt Mischel schriftlich unserer Zeitung mit.
Polnische Expertise
Dass das Land Niedersachsen auf die Zusagen der EU wartet, hat Gründe. Der wesentliche: Das Projekt wird zu einem großen Teil von Brüssel finanziert. Auf 75 Prozent bezifferte Sprecherin Mischel zuletzt den Anteil der errechneten „laufenden Kosten“ im Betrieb, die Niedersachsen nicht selbst zahlen muss. Über die Höhe der Gesamtkosten für die Miete pro Jahr schweigt sich das Ministerium noch aus. Ziel sei weiterhin, versichert das Ministerium, „unter der Beachtung der Empfehlung der EU kleine Löschflugzeuge mit einem Wasservorrat von mindestens 3000 Litern zu beschaffen“.
Der Landkreis Harz ist da weiter. Als erster Kreis in Deutschland hat er ein eigenes Löschflugzeug zur Brandbekämpfung angeschafft, die Kosten belaufen sich im Jahr auf 150.000 Euro. Flugzeug, Technik und der Pilot würden dabei von einem polnischen Fachunternehmen bereitgestellt, teilte der Landkreis mit. Das Modell des Typs PZL M-18 Dromader (deutsch: Dromedar) wurde demnach Mitte der 1970er-Jahre in Polen für den Betrieb auf unpräparierten Landebahnen, zu allererst für die Landwirtschaft, entwickelt. Ihr Neun-Zylinder-Sternmotor habe einen 30-Liter-Hubraum und eine Leistung von 1000 PS. Es sei sofort einsatzbereit, erklärte Landrat Thomas Balcerowski (CDU) bei Inbetriebnahme des Flugzeugs in der vergangenen Woche.
Waldbrand-Experten gehen davon aus, dass Niedersachsen auf vergleichbare Löschflugzeuge setzen wird. Hoch gehandelt wird demnach das Modell Air-Tractor 802, das die Wasservorratsmenge in etwa aufnehmen kann, auf die das Ministerium in seiner Ausschreibung verweist. Die Maschinen sollen auch Teil eines Ausleihgeschäftes mit anderen Bundesländern oder europäischen Staaten sein, sollte das die landesweite Gefahrenlage zulassen.
Auch im Landkreis Harz setzt man auf Kooperationen. Bei Bedarf, so ein Sprecher des Kreises gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, werde die einmotorige Maschine auch den Nachbarkreisen zur Verfügung gestellt. Maximilian Strache, Sprecher des Landkreises Goslar, bestätigte gegenüber unserer Zeitung erste Gespräche mit dem Nachbarkreis, konkrete Vereinbarung im Einsatzfall stünden allerdings noch aus. Mit Blick auf die anstehende Waldbrandsaison stehe man aber über Landkreis- und Landesgrenzen hinweg ständig im Austausch. „Sowohl auf der politischen Ebene in der AG Waldbrandbekämpfung Harz als auch im operativen Geschäft über die Ebene der jeweiligen Kreisbrandmeister“, so Strache.

Nachdem das Feuer am Brocken gelöscht ist, entbrennt nun eine Debatte um die Größe des Brandes und seine Folgen. Foto: Matthias Bein/dpa
Brandschutz-Hotspot
Zuletzt hatte Ministerin Behrens die Notwendigkeit des Landes betont, den Brand- und Katastrophenschutz zu stärken. Anlässlich einer gemeinsamen Übung der Polizeihubschrauberstaffeln aus Niedersachsen, Sachsen und Bayern nahe Oldenburg hatte sie erklärt: „Wir müssen hinsichtlich der Folgen des Klimawandels gewappnet sein, denn Wald-, Moor- und Vegetationsbrände machen auch vor Landesgrenzen nicht halt.“
Potenzielle Kandidaten für den künftigen Standort der Löschflugzeuge haben jedoch noch keine Rückmeldung vom Ministerium erhalten. Der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg hat nach eigenen Angaben seinen „Hut in den Ring geworfen“ und warte nun auf Antwort aus Hannover. Experten wie der Vechelder Waldbrandbekämpfer Detlef Maushake oder Sebastian Drews, der mit seiner Firma „Beconda“ im Kreis Wolfenbüttel Feuerwehrleute ausbildet, hält die Region Braunschweig auch wegen ihrer geografischen Nähe zu potenziellen Waldbrand-Hotspots wie Heide und Harz für prädestiniert.
Das sieht Torsten Hensel aus der Region Lüneburg ähnlich. Er leitet einen von zwei Stützpunkten der Flugfeuerwehren in Niedersachsen, von denen aus während der Waldbrandsaison Erkundungsflüge gemacht werden. Lüneburg scheidet laut Hensel als Wartungsstandort für die Löschflugzeuge aus. Dabei sieht die Ausschreibung der EU zwei oder mehr Standorte vor. Einen Hauptstandort („Main Base“), an dem Löschflugzeuge sowie Crew, Wartungsmaterial und weitere Ausrüstung im späteren Einsatzzeitraum vorgehalten werden, sowie Ersatzstandorte, sogenannte „Secondary Bases“.
Die Vorhaltung dieser zusätzlichen Anflugmöglichkeiten dient einsatztaktischen Zielen. Primär sollen damit Umlaufzeiten der Flugzeuge zwischen Abwurf- und Auftankstelle minimiert werden, heißt es aus dem Ministerium in Hannover.
Kreisbrandmeister Hensel, seit 2004 in der Flugüberwachung tätig, bestätigt, dass sich die Waldbrandgefahr verlagert habe. Abgesehen davon, dass 2022 ein extremes Jahr gewesen sei, habe ursprünglich das Hauptaugenmerk auf den Kreisen im Umfeld der Lüneburger Heide gelegen – unter anderem Gifhorn, Celle, Lüchow-Dannenberg. In den vergangenen Jahren sei der Harz als neuer Waldbrand-Hotspot dazugekommen. „Das vermehrte Totholz, das dort liegen bleibt, brennt wie Zunder“, beschreibt Hensel ein Problem, das auch die Feuerwehren am Boden schon ausgemacht haben.
Der Landkreis Harz gab für 2022 an, in mehr als 200 Fällen zu Wald- und Vegetationsbränden ausgerückt zu sein. Besonders häufig lagen die Brandherde demnach im Umfeld der Harzer Schmalspurbahn, wie eine Anfrage der Grünen-Landtagsfraktion im sachsen-anhaltinischen Landtag ergab.

Ein italienisches Löschflugzeug bekämpft einen Waldbrand am Brocken. Hunderte Einsatzkräfte bekämpften 2022 einen großen Waldbrand im Harz. Symbolfoto: picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte
Rasches Austrocknen
Trotz hoher Regenmengen im ersten Drittel des laufenden Jahres warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) davor, sich, mit Blick auf die Waldbrandgefahr, in falscher Sicherheit zu wiegen. Christoper Böttcher, DWD-Mitarbeiter am Zentrum für Agrarmeteorologische Forschung in Braunschweig, erklärt: „Die Waldbrandgefahr war im März aufgrund der feuchten Witterung gering. Im Vergleich mit dem langjährigen Mittel ist das häufig der Fall. Wenn die Witterung aber trocken und warm wird, dann kann die Waldbrandbrandgefahr schnell ansteigen. Hier hilft die gespeicherte Feuchtigkeit nur wenige Tage.“
Besonders im Frühjahr könne die Laubschicht am Boden besonders schnell austrocknen, weil die Bäume noch keine Blätter haben und der Sonnenschein fast ungehindert die Streuschicht trifft, so Böttcher. Außerdem sei die lebende Bodenvegetation zu diesem Zeitpunkt kaum entwickelt, die zusätzliche Feuchtigkeit aus tieferen Bodenschichten verfügbar machen würde.
Für das Innenministerium in Hannover ergibt sich aus der Analyse des DWD auch ein Auftrag: Bei der Anschaffung der Löschflugzeuge nicht weiter Zeit zu verlieren, will man nicht erneut auf fremde Hilfe angewiesen sein.
Wir müssen hinsichtlich der Folgen des Klimawandels gewappnet sein, denn Wald-, Moor- und Vegetationsbrände machen auch vor Landesgrenzen nicht halt.
Von Dirk Breyvogel, Funke Medien Gruppe