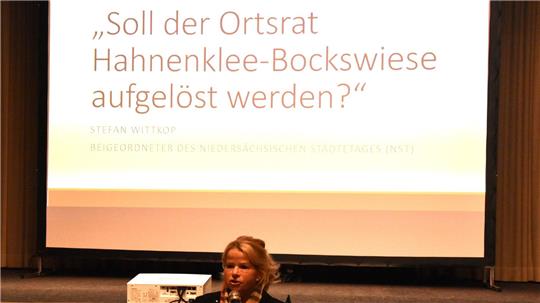Personalnot: Goslars Handwerk sucht dringend Fachkräfte

Bloß nicht den Überblick verlieren in Zeiten, in denen eine Lehre im Handwerk immer anspruchsvoller wird: Im Ausbildungszentrum der Siemens Professional Education (SPE) in Leipzig trainiert eine Auszubildende zur Elektronikerin unter den Augen ihres Ausbilders an einem modularen Produktionssystem. Archivfoto: Hendrik Schmidt/dpa
Fachkräftemangel und Nachwuchsprobleme sind nicht erst seit gestern ein besorgniserregendes Problem für das Handwerk. Was das in der Praxis bedeutet und wo genau der Schuh drückt, weiß Kreishandwerksmeister Bernhard Olbrich für die Elektro-Branche.
Goslar. Wer im Internet auf der Firmenseite von Goslars Kreishandwerksmeister Bernhard Olbrich unterwegs ist, findet schnell ein klares Bekenntnis: „Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind unser wichtigstes Kapital. Regelmäßige Fortbildungen und Nachwuchsförderung haben bei uns einen hohen Stellenwert.“ Olbrichs Problem: Er hätte gern noch viel mehr von ihnen.

Klingel ist längst nicht mehr gleich Klingel: Kreishandwerksmeister Bernhard Olbrich demonstriert im eigenen Elektronik-Betrieb, welch vielfältigen Varianten es gibt. Foto: Heine
Unrealistische Erwartungen und Fehlentwicklungen
Was läuft falsch? Wer diese Frage stellt, bekommt ein dickes Bündel von Antworten. Sie handeln von gestiegenen Anforderungen in den einzelnen Berufen, von unrealistischen Erwartungshaltungen nach der Schule, aber auch von Fehlentwicklungen in der Schule und in einer Gesellschaft, in denen oft gerade Eltern das Studieren für ihre Sprösslinge als das Non-plus-ultra ansehen. Beispiel Schule: „Wer das Abitur hatte, gehörte zu meiner Zeit zur Elite der Bevölkerung“, schildert Olbrich seine Sicht. Aber kann es noch eine Elite sein, wenn heute schon mehr als die Hälfte eines Jahrgangs das Gymnasium besucht? Wo übrigens auch kein Unterricht im Werken mehr erteilt werde, in dem der Nachwuchs das Gefühl für und die Liebe zum Schaffen mit den eigenen Händen entwickeln könnte.
Olbrich plädiert zudem massiv für gezielte Praktika, in denen sich die Jugendlichen mit ihren Wunschberufen unter realistischen Bedingungen auseinandersetzen sollten. Wie lange dauert die Arbeit? Wie anstrengend ist der Job? Wann klingelt morgens der Wecker? Welcher Lohn winkt für die Arbeit? „Es ist einfach nur schade, wenn nach kurzer Zeit Lehrstellen geschmissen werden, die andere liebend gern gehabt hätten“, warnt er vor einem solchen Blockieren des Systems, dessen einzelne Berufe für manch anderen eben auch eine Erfüllung darstellen könnten.
Seit 27 Jahren bildet Olbrich in seinem Betrieb den Nachwuchs aus
Und er weiß sehr gut, wovon er spricht: „Ich bilde im Betrieb seit 27 Jahren aus und stelle in der Regel immer vier neue Lehrlinge pro Jahr ein“, rechnet er vor. Während in den ersten 23 Jahren insgesamt nur zwei von ihnen ihre Lehre abgebrochen hatten, erlebte Olbrich zuletzt, das ihm unterwegs ein kompletter Ausbildungsjahrgang verloren ging. Das will niemand erleben.
Natürlich: Der Job ist anspruchsvoller geworden. Er verlangt viel mehr Wissen und immer wieder Fortbildung, um auf dem neusten Stand zu sein. „In meinem eigenen Gesellenbrief steht noch Elektroinstallateur, heute heißt es Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik“, erzählt er mit einem Schmunzeln. Digitale Steuerungen, die Smart-Homes, immer höhere Ausstattungen gerade im privaten Wohnraum: „Es kann nicht mehr einer alles können“, sagt Olbrich und verweist auch auf Überlappungen mit anderen Branchen – etwa mit Heizung und Sanitär beim Anschluss von Wärmepumpen oder mit dem Kfz-Handwerk in der E-Mobilität.
Konkurrenz droht auch aus der Industrie
Was nach Olbrich auch niemand vergessen darf: Die Arbeit muss auch schon deshalb angemessen und gut bezahlt sein, um Abwerbungen aus der Industrie zu verhindern. Geschulte Kräfte mit handwerklichem Geschick sind dort auch immer gern gesehen und genommen. „Eine Handwerkerstunde wird immer teurer“, weiß aber auch Olbrich um das große Problem, das am Ende ein Kunde die Rechnungen bezahlen muss. Kunden, die manchmal mit Argusaugen darüber wachen, was denn Lehrlinge bei Hausbesuchen tun und wie sie abgerechnet werden.
„Im ersten Jahr schreibe ich deshalb nichts auf“, sagt Olbrich und rechnet vor, dass ihn diese Praxis rund 15.000 Euro pro Azubi-Kopf mit weiteren Schulungen kostet. Aber ab dem zweiten Lehrjahr wird der Einsatz berechnet. Weil dann mit Sicherheit Fachwissen vorhanden ist. Und weil Ausbildung sonst auch irgendwann unmöglich wird. Genau diese Frage hat Olbrich auch schon einmal einem besonders sparsamen Kunden gestellt: „Wer bildet denn sonst überhaupt noch aus?“
Überstunden sind ein zweischneidiges Schwert
Wenn die Zahl der klugen Köpfe und flinken Hände zu knapp und die Arbeit zu viel ist: Warum helfen nicht Überstunden weiter? Ein zweischneidiges Schwert, hadert Olbrich. Auf der einen Seite be- und überlastet dieses Instrument eine Belegschaft, wenn es auf Dauer eingesetzt wird. Irgendwann muss Zeit zum Ausruhen sein. Und weil so gut wie niemand die Überstunden bezahlt haben, sondern sie abfeiern möchte, handele es sich um ein „Nullsummenspiel“. Deshalb fordert Olbrich auf der anderen Seite aber auch, dass Überstunden von Abgaben entlastet werden müssten, damit „der, der mehr arbeitet, am Ende auch mehr in der Tasche hat“. Wobei er weiterhin vorrangig auch mit Gewerkschaftsforderungen geht, mehr Leute einzustellen. Wenn sie denn da wären.
Helfen Fachkräfte aus dem Ausland? Ja, weil er selbst und andere mit Fleiß und Einsatzbereitschaft der Menschen wirklich gute Erfahrungen gemacht hätten. Nein, jedenfalls nicht kurzfristig, wenn es nicht darüber hinaus das Bewusstsein gebe, auch die sprachlichen Barrieren abbauen zu müssen. „Die Sprache ist der Schlüssel zu allem“, sagt Olbrich, der aber auch selbstkritisch ist und die wenig flexiblen Prüfungsverordnungen anspricht, die wenig Möglichkeiten zur Hilfe oder Erleichterung böten. Hier seien Ideen und Initiativen gefragt – von allen Seiten.
Hintergrund: Zahlen, Wünsche und Forderungen
Wie die Zahl der Auszubildenden in der Elektrotechnik im Landkreis Goslar in den vergangenen Jahren zurückgegangen ist, verdeutlicht eine Entwicklung, die Geschäftsführer Michael Wolff von der Kreishandwerkerschaft Süd-Ost-Niedersachsen anhand der Neueinträge in die Lehrlingsrollen darstellt. Im Vorjahr kamen nur 24 neue Azubis dazu. 2021 waren es noch 28, im Jahr 2020 immerhin 31 und im Jahr 2019 noch 36.
Auch Pressesprecher Stefan Freydank von der Agentur für Arbeit Braunschweig-Goslar stellt Zahlen zur Verfügung. Danach kamen Ende September nur für das Goslarer Gebiet auf 15 Lehrstellen für Energietechnik 15 Bewerber, fünf Stellen blieben aber unbesetzt. Bei Elektrotechnik gab es keine Stellen, aber vier Bewerber. Die Statistik weist Ende Dezember 2022 für den Landkreis Goslar für die Energietechnik 25 gemeldete Stellen aus – alle für Fachkräfte. Bei der Elektrotechnik sieht es 24 Stellen quantitativ ganz ähnlich aus. Aber neben drei Fachkräften werden hier vor allem Helfer (10) und Spezialisten (11) gesucht.
In einem Beitrag für die „Welt“ hat unter anderem Landesinnungsmeister Karsten Krügener aus Bad Grund für eine bessere Fachkräfte-Anwerbung im Ausland geworben und ein Umdenken in der deutschen Bildungspolitik weg vom Studien-Dogma gefordert. Schulabschlüsse müssten wieder mit Niveau gefüllt werden, Schülern sollte nach der vierten Klasse eine Schulart verbindlich empfohlen werden, und Sitzenbleiben müsse wieder überall möglich sein. Eine verbesserte Berufsorientierung sei unabdingbar.