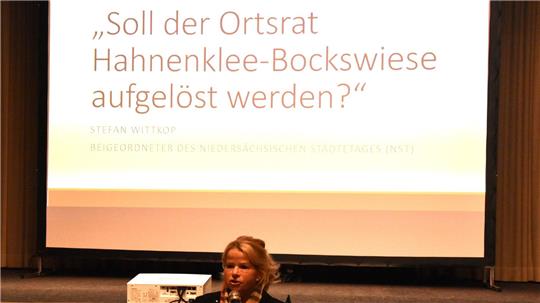Der Polizeiberuf „zählt zu den emotional gefährlichsten der Welt“

Ein Polizist steht vor einem Wohnhaus. Nach dem Fund einer Leiche in einem Haus ermittelt die Mordkommission zu einem Gewaltverbrechen. Foto: dpa
Unfälle, Leichen, Missbrauch, Waffen und Übergriffe – Wer bei der Polizei arbeitet, hat keinen leichten Job. Was die Beamten Tag für Tag sehen müssen, übersteigt unsere Denk- und Vorstellungskraft. Posttraumatische Beschwerden sind deshalb häufiger die Folge.
Salzgitter. Auf einem Acker im Kreis Peine steht ein Auto. Die Scheiben sind rußverschmiert. Im Innern finden Polizisten einen 55-Jährigen. Der Körper gezeichnet von einem Feuer und Schnitten. An seiner Anschrift stoßen Beamte auf eine zweite Leiche – die 83 Jahre alte Mutter des Mannes. Sie trägt Spuren schwerer Gewalt. Der Sohn griff die Mutter mit einer Axt an und richtete sich selbst, glauben die Ermittler, nach dem doppelten Leichenfund von Bettmar Mitte Mai.
„Solche Fälle sind für alle Seiten eine Tragödie“, sagt Christian Priebe, Leiter des örtlichen Polizeikommissariats. „In erster Linie für die Opfer und ihre Familien. Aber auch für die eingesetzten Beamten.“
Sie sehen zerschmetterte Menschen, blicken in Abgründe. Polizist zu sein, zählt zu den emotional gefährlichsten Berufen der Welt, sagt die Tübinger Kriminalpsychologin Ursula Gasch. „Das sind Extremfälle, die unsere Denk- und Vorstellungswelt überschreiten“, sagt die Professorin Birgitta Sticher. „Wenn sich solche Erfahrungen häufen, steigt die Gefahr, dass die Belastung die Bewältigungsmöglichkeiten überschreitet“, der Punkt, an dem das sprichwörtliche Fass überläuft. „Das Thema bleibt ein Problem innerhalb der Polizei“, sagt Sticher. Doch warum?
„Wir“ und „die“
Eigentlich sind Polizisten gesünder als der Bevölkerungsdurchschnitt – jedenfalls zum Zeitpunkt der Einstellung. Danach geht es bergab. Zwischen 13 und 32 Prozent der Polizisten klagen über Symptome, die einem psychischen Störungsbild zuzuordnen sind, sagt Sticher, Professorin für Psychologie und Führungswissenschaft an der Berliner Hochschule für Wirtschaft und Recht. Seit 1998 bildet sie Polizistinnen und Polizisten aus.
Einer niederländischen Studie zufolge leidet mehr als jeder siebte Polizeibeamte unter posttraumatischen Beschwerden, ausgelöst durch lebensbedrohliche und hochemotionale Situationen. Sei es in Folge eines Schusswaffengebrauchs, sei es an einem Tatort oder bei Übergriffen im Einsatz.
Konkrete Zahlen sind Mangelware. Weder die für die Region zuständige Polizeidirektion Braunschweig noch das Landesinnenministerium verfügen über entsprechende Daten – der Datenschutz verhindert das.
Auch für Forscher ist es tendenziell ein schwieriges Feld. Wer redet gern über seelische Qualen – wenn die Kollegen davon erfahren oder Hilfe einzufordern als Schwäche ausgelegt werden könnte? Zumal das Gruppengefühl bei der Polizei ausgeprägt ist, sagt die Tübinger Kriminalpsychologin Gasch. „Es gibt eine klare Grenze. Auf der einen Seite die Polizisten – auf der anderen die da draußen.“
Krankmachende Bilder
Aber nicht nur die direkte Konfrontation mit Gewalt ist belastend. Es kann reichen, sie am Bildschirm zu sehen – und nicht wegschauen zu dürfen. Videos von Misshandlungen und Hinrichtungen etwa. „Der stärkste Tobak ist aber die Auseinandersetzung mit kinderpornografischem Material“, erklärt Kriminalpsychologin Gasch. Missbrauchsabbildungen, auf denen Kinder zu sehen sind – wie im Fall eines Kriminalbeamten in Salzgitter. Der psychisch vorbelastete Kommissar sichtet solche Aufnahmen. Monate später berichtet er von Schlafproblemen, Unruhe, Angstzuständen. Ein Gutachter attestiert ein Trauma. Inzwischen befindet sich der Mann im vorzeitigen Ruhestand.
„Die Beamten, die sich das ansehen müssen, sind quasi im Tatgeschehen mit drin“, sagt Psychologin Ursula Gasch. Dass Bilder traumatisieren können, „kennen wir von Untersuchungen mit Drohnenpiloten“. Und die Menge des zu sichtenden kinderpornografischen Materials steigt seit Jahren. Bei der Kriminalpolizei Salzgitter, auch für Peine und Wolfenbüttel zuständig, ist mittlerweile nahezu jeder sechste Ermittler mit Missbrauchsabbildungen befasst.
Seelische Störung
„Nicht jedes stressige Ereignis muss zu einem Psychotrauma führen“, sagt die Rechtspsychologin und Traumatherapeutin Gasch. Es komme auf die psychische Widerstandsfähigkeit an – und darauf, wie Ereignisse verarbeitet werden.
In Extremsituationen schüttet das Gehirn Stresshormone aus – eine Notfallreaktion des Körpers. Kämpfen oder Fliehen sind die instinktiven Optionen. Bei Traumatisierten sinkt das Stressniveau danach nicht ab, „der Notfallknopf des Körpers bleibt dauerhaft gedrückt“, sagt Gasch. Das kann bei einem einzelnen Vorfall passieren oder durch eine Häufung. Und es gibt Faktoren, die Traumafolgestörungen begünstigen.

Immer wieder richten sich Angriffe auch gegen Polizeibeamte. Foto: dpa
Einige von ihnen treten im Polizei-Apparat gehäuft auf, berichtet die Berliner Professorin Birgitta Sticher: „Personalmangel führt beispielsweise dazu, dass nicht genügend Ruhephasen da sind. Dazu kommt der hohe Krankenstand. Das ist ein Teufelskreis.“ Teilweise gebe es zudem „gewisse Führungsinkompetenzen“. Das zusammen führe dann dazu, dass Beamte über ihre Grenzen belastet würden.
Erschwerend kann Frust wirken. Polizist zu sein, ist für viele Beamte ein „Traumberuf“, so Sticher. „Die Motivation bei vielen ist hoch. Sie wollen diese Arbeit machen – um etwas Sinnvolles zu tun.“ Wird dieses Gefühl enttäuscht, sinken die Widerstandskräfte.
PTBS – was heißt das?
Reizbarkeit, Stimmungsschwankungen und Charakterveränderungen oder der soziale Rückzug können erste Warnsignale sein, sagt Ursula Gasch. Oftmals zeige sich eine PTBS (Posttraumatische Belastungsstörung) verzögert, es kann Monate dauern, bis Symptome auftreten: „Betroffene scheinen zunächst unbeeindruckt.“ Sie wollen oder können anfangs nicht über ihre Erlebnisse reden.
Später kommen Symptome wie Albträume und „Flashbacks“ – Situationen, in denen Betroffene im Moment des traumatischen Ereignisses gefangen sind. Gasch nennt das Beispiel eines Ermittlers, der einen Erhängten auf dem Dachboden fand. Neben ihm spielte ein Plattenspieler in Dauerschleife das Lied „Time to say goodbye“.
Im Alltag holten die Bilder den Mann immer wieder ein, er sieht die Situation vor seinem inneren Auge und hört die Musik. „Das Gedächtnis macht keinen Unterschied mehr zwischen früher und heute. Sie werden von den Emotionen überwältigt. Das ist unkontrollierbar.“ PTBS-Betroffene entwickelten zudem weitere psychischen Erkrankungen wie Depressionen und Süchte.
Polizisten sind Menschen. Eine banale Erkenntnis – doch lange Zeit wurde der Mensch in der Uniform kaum gesehen. Erst seit etwa zehn Jahren existiert bundesweit eine professionelle psychosoziale Einsatznachsorge, sagt Birgitta Sticher. Bedingt durch Missbrauchsfälle wie in Lügde oder dem Terroranschlag vom Breitscheidplatz sei die Sensibilität für das Thema in der Polizei gewachsen. Doch noch immer gebe es Hemmschuhe: Sie lägen im Berufsverständnis mancher Beamter, aber auch in der Führungskultur des Apparats.
„Härte“ als Qualität?
Angehende Polizisten werden in der Ausbildung vorbereitet: Dazu gehören entsprechende Fotos oder der Besuch in der Gerichtsmedizin. Genau wie Informationen zu den fachlichen Grundlagen, professionellem Selbstverständnis oder der Fähigkeit, sich abzugrenzen. Die Theorie ist das eine.
In der Praxis hilft es zu reden. Sei es unter Kollegen oder in professionellem Rahmen. Entsprechende Angebote existieren innerhalb der Polizei, sagt Professorin Sticher. „Beim Thema psychosoziale Unterstützung hat sich einiges getan“.
Meist sind diese Angebote freiwillig. So auch in Niedersachsen und damit in der Polizeidirektion Braunschweig. Auf deren Gelände in der Friedrich-Voigtländer-Straße ist seit 1999 die „Regionale Beratungsstelle“ angesiedelt. Beamte können sich an die Mitarbeiter wenden, „ohne, dass ihr Name an Vorgesetzte weitergegeben wird“, erklärt der Peiner Kommissariatsleiter Priebe. Darüber hinaus erfolgten nach belastenden Einsätzen eingehende Nachbesprechungen.
Doch was, wenn Hilfesysteme ins Leere laufen? Schon im Studium sei das ein Problem, beobachtet Professorin Sticher: „Viele angehende Polizisten in Krisen haben Angst, Unterstützung zu holen, weil sich das auf ihre Übernahme ins Beamtenverhältnis auswirken könnte.“ Ein Muster, das sich fortsetze.

Einer niederländischen Studie zufolge leidet mehr als jeder siebte Polizeibeamte unter posttraumatischen Beschwerden, ausgelöst durch lebensbedrohliche und hochemotionale Situationen. Foto: dpa
Ältere Beamte tun sich beim Thema psychische Gesundheit schwerer als jüngere, Männer schwerer als Frauen – und Beamte im Einsatz- und Streifendienst noch einmal schwerer als Kriminalpolizisten, beobachtet Sticher. Weil bei Schutz- und Bereitschaftspolizei ein anderes Bild von Männlichkeit vorherrsche. „Die verstehen sich als Krieger und tun sich schwerer, über Emotionen nachzudenken.“ Als Boomerang wirke sich das Pflichtbewusstsein vieler Beamter aus, sagt Ursula Gasch. „Man will nicht ausfallen – und ignoriert die Symptome.“
Das Resultat: Angebote werden nicht unbedingt in Anspruch genommen. Aus Angst, als schwach wahrgenommen zu werden. Hilfe zu suchen sei ein Stigma, das sich Betroffene selbst auferlegen, das aber durch Kollegen verstärkt werden kann. Dabei ist genau das Gegenteil richtig, so Birgitta Sticher: Es ist notwendig, sich mit psychischen Belastungen auseinanderzusetzen, um gesund zu bleiben.
Besonders Führungskräften komme eine wichtige Rolle zu. Dafür bedürfe es eines größeren Wissens um psychische Erkrankungen. Dass Krankheiten und daraus resultierende Einschränkungen nicht in Stein gemeißelt sind, sondern sich verändern. Dass Betroffene Geduld, Wertschätzung und Empathie brauchen. Ihr Eindruck: „Nicht bei jeder Führungskraft der Polizei ist das angekommen.“
Traumata
Die Professorin betont: „Heute weiß man, dass es auf viele Faktoren ankommt, um mit belastenden Ereignissen umzugehen: Wie bin ich vorbereitet, um welches Ereignis geht es, wie wird es nachbereitet, wie fängt mein Team das auf, wie ist das Klima, in das ich eingebettet bin.“
Doch wackeln Säulen in diesem Konstrukt, steigt das Risiko, dass es kippt. Darin sieht sie eine doppelte Gefahr. Nicht nur für einzelne Beamte. Sondern die Polizei als Ganzes und die Gesellschaft. Wenn Menschen Belastungen nicht verarbeiten, „dann werden sie feindseliger und nehmen ihre Umwelt anders wahr“. Solche Polizisten „neigen viel stärker zu Gewalt und rassistischen Einstellungen.“ Im privaten Bereich wie auch im Dienst. Und genau das „ist ja eine Polizei, wie wir sie nicht wollen“.
Von Erik Westermann, Funke-Mediengruppe
Kostenlos aufs Handy: Immer top informiert mit den Telegram-Nachrichten der Goslarschen Zeitung!