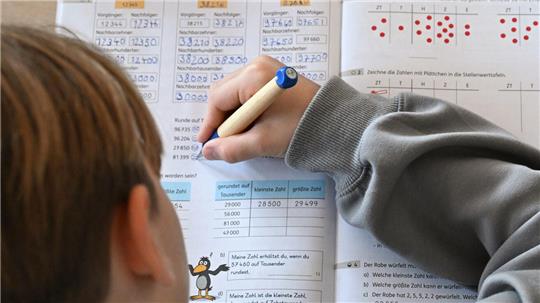Telenotfallmedizin: 140 Fachleute informieren sich in Goslar

Nicht am Unfallort, aber trotzdem live dabei: Dr. Thomas Marian erklärt die Arbeit eines Telenotarztes. Er selbst verbringt 75 bis 80 Prozent seiner Arbeitszeit bei Einsätzen vor Ort und den Rest als Tele-Mediziner in der Zentrale. Fotos: Hartmann
Das Goslarer Pilotprojekt zur Telenotfallmedizin stößt landesweit auf Interesse. 140 Vertreter von Rettungsdiensten aus ganz Niedersachsen kamen am Mittwoch ins Kreishaus und informierten sich darüber, wie der Arzt per Smartphone helfen kann.
Goslar. Personalmangel, weite Strecken, abgelegene Dörfer und immer mehr Menschen, die die 112 wählen – das alles führt dazu, dass es im Harz oft schwer ist, den Notarzt rechtzeitig zum Einsatzort zu bekommen. Der Landkreis Goslar hat aus der Not eine Tugend gemacht und im Rahmen eines Pilotprojekts die Telenotfallmedizin eingeführt. Gestern waren 140 Vertreter niedersächsischer Rettungsdienste im Kreishaus zu Gast, um sich über das „Erfolgsmodell“ zu informieren.
Telenotfallmedizin bedeutet, dass nicht immer ein Notarzt direkt vor Ort sein muss, wenn es um die Versorgung von Patienten geht. Der Telearzt wird von den Notfallsanitätern per Smartphone dazugeschaltet, kann per Kamera und Mikrofon mit Helfern und Patienten kommunizieren und erhält die Vitaldaten in der Zentrale auf den Bildschirm. So entfällt viel Fahrzeit, in der die „knappe Ressource Notarzt“ für andere Einsätze zur Verfügung steht. Seit der Einführung in Goslar im Jahr 2021 hatten die Telenotärzte 4850 Einsätze. Im Jahr 2022 gab es insgesamt 5200 Notarzteinsätze und 1100 Einsätze für den Telenotarzt. Seit Februar 2024 bilden die Landkreise Emsland und die Grafschaft Bentheim mit ihrer Rettungsleitstelle Ems-Vechte einen weiteren Pilot-Standort.
Blick durch ein kleines "Schlüsselloch"
Dr. Tobias Steffen, Ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes im Landkreis, berichtete über die bisherigen Erfahrungen. Wichtig sei ihm, dass das gesamte Thema immer aus fachlicher Sicht und nicht aus der Sicht auf die technische Struktur heraus entwickelt werde. Man habe die Kommunikation bewusst einfach gestaltet und ein Smartphone genutzt. Alle Telenotärzte hätten Erfahrung im Rettungsdienst und Führungserfahrung beispielsweise als Oberärzte und könnten die Situation vor Ort, die sie ja nur durch ein kleines „Schlüsselloch“ sehen, gut einschätzen.
„Es wird auch in Zukunft Einsätze geben, bei denen ein Notarzt vor Ort sein muss“, betonte Steffen. Aber das sei nicht immer der Fall: „Bei 46,7 Prozent aller Notarzteinsätze hielten sich die Notärzte für nicht erforderlich, waren jedoch im Mittel mindestens 25 Minuten vor Ort an der Einsatzstelle gebunden“, so Steffen. Der Einsatz des Telearztes führe dazu, dass der Notarzt verfügbar bleibt, wenn er wirklich gebraucht wird. Auch sei es vorteilhaft, den Telearzt zusätzlich zu alarmieren, wenn ein Notarzt nicht schnell genug am Einsatzort eintreffen kann.
Nur ein Fall gleichzeitig
Eine Idee, die zu Beginn des Pilotprojekts im Raum gestanden hatte, habe sich jedoch als unrealistisch erwiesen: Dass ein Telenotarzt zeitgleich drei Notfälle betreuen könne, sei nicht praktikabel, betonte Steffen. Es bleibt bei einem Notfall gleichzeitig, ob als Telearzt oder vor Ort. Ganz wichtig: „Telenotfallmedizin ersetzt nicht den Notarzt, sondern ergänzt ihn.“
Über Möglichkeiten zur Ausweitung der Telenotfallmedizin auf ganz Niedersachsen informierte Sonja Gonschorek vom Referat Rettungswesen des niedersächsischen Innenministeriums. Die nötigen gesetzlichen Grundlagen – für Goslar gelten bisher die Sonderregeln eines „Pilotprojekts“ – sollen noch in diesem Jahr geschaffen werden. Ziel sei es, Telenotfallmedizin in Niedersachsen flächendeckend, landesweit einheitlich und landesweit vernetzt vorzuhalten. Grundsätzlich solle es ein „Hybrid-Modell“ sein, in dem Land und Kommunen sich die Aufgabe teilen, eine Vereinigung von Personal und Technik. Das Land werde für die Beschaffung der notwendigen Technik sorgen. Welches System das sein werde, steht noch nicht fest, hierzu müsse erst noch eine Ausschreibung erfolgen. Die Dokumentation der Einsätze sei Sache der Kommunen, hier solle auch das System genutzt werden, das bereits vor Ort verwandt wird.
Organische Entwicklung
Insgesamt solle sich die Zahl der Telemedizin-Standorte organisch entwickeln und wie eine Pflanze wachsen. Kommunen müssten bestimmte Voraussetzungen erbringen und könnten sich dann bewerben. Benötigt werden eine geeignete Rettungsleitstelle, ein „24/7“-Konzept für qualifizierte Telenotfallärzte und ein verantwortlicher Ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes mit ausreichenden Arbeitszeitanteilen.
Nach den Vorträgen konnten die Zuhörer sich anschauen, wie ein Telenotarzt und ein Notfallsanitäter per Smartphone zusammenarbeiten. Während Notarzt Dr. Thomas Marian im Sitzungssaal am Rechner blieb, simulierten die Notfallsanitäter Sven Zuse und Lina Krebs vor dem Kreishaus einen Einsatz: Krebs hatte sich eine schwere Verletzung zugezogen und wollte nicht ins Krankenhaus. Klar, dass der Telenotarzt den Fall auch aus der Ferne betreuen konnte. Der Kontakt mit den Patienten sei per Smartphone sehr gut, versichert Marian. Auch Ältere seien durch die Corona-Zeit an Gespräche via Bildschirm gewöhnt und würden positiv reagieren.

Die beiden Notfallsanitäter Lina Krebs und Sven Zuse simulieren einen Einsatz.

Dr. Tobias Steffen