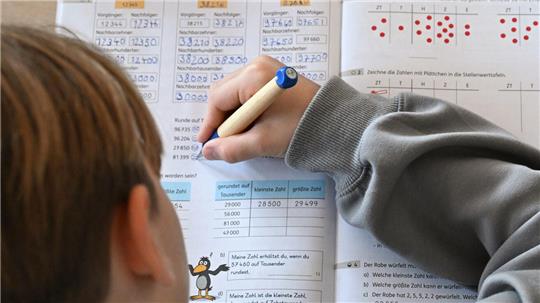Ein SS-Mann als Vater – Lesung in Liebenburger Lewer Däle

Christel Leuner und Dirk Kaesler stellen das Buch „Lügen und Scham“ vor. Foto: Hartmann
Um die Nazi-Einrichtung „Lebensborn“ und die Suche nach einem SS-Vater ging es in der Lewer Däle in Liebenburg. Soziologe Dirk Kaesler las aus seinem Buch „Lügen und Scham“ vor und erzählte von der „Arier“-Zuchtstätte und ihren Folgen.
Liebenburg. Es ist Donnerstag, 17. November 1977. Ein 33-jähriger Sohn wartet in einem Restaurant auf seinen 67-jährigen Vater, den er seit 28 Jahren nicht mehr gesehen hat. Keine fröhliche Familienzusammenführung. Der Sohn will mit seinem Erzeuger ein knallhartes Verhör führen. Am Ende geht der Vater nach Hause und meint fröhlich: „Das sollten wir von jetzt an öfter machen.“ Und der Sohn empfindet nur noch Ekel. Er wird nie wieder mit dem Mann reden.
Dirk Kaesler – Soziologieprofessor, Schriftsteller, unehelicher Sohn eines Waffen-SS-Mannes und in einer Entbindungsstätte der nationalsozialistischen „Arier“-Zucht-Einrichtung „Lebensborn“ zur Welt gekommen – stellte als Gast der Lewer Däle in Liebenburg sein autobiografisches Buch „Lügen und Scham – Deutsche Leben“ vor. Dabei wurde er unterstützt von der Schauspielerin Christel Leuner, die in der szenischen Lesung Kaeslers Mutter ihre Stimme lieh.
161 Seiten Protokoll
Der Soziologe hatte viel zu erzählen, viel aufzuarbeiten. Immer wieder befragte er seine Mutter nach den Kriegsjahren und nach ihrer Beziehung zu dem SS-Mann. Die abgetippten und ausgedruckten Fassungen der Tonbandmitschnitte machten später insgesamt 161 Seiten aus. Die Mutter war eigentlich mit einem anderen Mann verheiratet. Dass er selbst einer unehelichen Beziehung mit einem SS-Mann entstammte, erfuhr der Sohn erst als Erwachsener. Der biologische Vater war verheiratet, hielt die Mutter immer wieder hin mit Geschichten über ein vermeintliches Scheidungsverfahren, das sich über Jahre hinzog, finanzierte Mutter und Sohn wohl eine Zeit lang, bis er untertauchte. Nach dem Tode der Mutter erbte der Sohn auch die Briefe, die sein Vater ihr geschrieben hatte, und zeigt sich noch immer betroffen über die „Rotzigkeit, Arroganz und unfassbare Unmenschlichkeit dieser Korrespondenz“.
Und doch: Für die Mutter war es offenbar die große Liebe. „Er sah ja so gut aus. Wenn er rein kam, dann wusste jeder, wer da kommt“, lässt Schauspielerin Leuner die brüchige Stimme der alten Frau zum Leben erwachen. „Ein Herr halt, er war einfach jemand. Weil er etwas vorstellte.“
Rund 70 Zuhörer im evangelischen Gemeindehaus begleiteten Kaesler auf seiner Spurensuche, irgendwo zwischen akribischer Recherche und dem Gefühl, nichts mehr mit dem Mann zu tun haben zu wollen, der sein Erzeuger war. Viele der Zuhörer nutzten die Gelegenheit, nach der Lesung über die Einrichtung des „Lebensborns“ zu diskutieren, in der die Nazis Kinder züchteten, die den Idealen ihrer „Herrenrasse“ entsprachen – blond, blauäugig und mit weiteren genau definierten Körpermerkmalen. Auch im Harz gab es solche Einrichtungen, die nächsten liegen in Wernigerode und Stapelburg, wie einige der Zuhörer wussten.
Anders als im Film
Aber: Das typische Lebensborn-Schicksal gibt es nicht, betonte Kaesler. Grundsätzlich seien in den Einrichtungen drei Arten von Kindern geboren und aufgezogen worden: Zum einen Kinder aus SS-Familien, deren Eltern hier die beste Versorgung für ihre Sprösslinge fanden. Ferner ledige Mütter, die von einem SS-Mann schwanger waren. Drittens schließlich geraubte Kinder aus den Kriegsgebieten – besonders von Kindern aus Norwegen versprachen sich die Nazis bestes Genmaterial für ihre „Arier-Zucht“. Womit Kaesler grundsätzlich aufräumt, sind Vorstellungen von Lebensbornstätten, in denen SS-Männer massenhaft Frauen beschliefen. Das sei ein Film-Klischee und habe mit der Realität nichts zu tun.
Kaeslers Suche nach dem Vater bleibt Fragment. Ekel vor dem Mann, dem er im Buch nicht einmal den richtigen Namen gönnt, lässt ihn vor weiteren Recherchen und der detaillierten Abrechnung zurückscheuen, auch wenn er sagt: „Dies Buch ist meine Rache an ihm.“ So wurde das Werk mehr zu einem Heldenlied auf die alleinerziehende Mutter, die sich und ihren Sohn nach dem Krieg allein durchbrachte.
Letzten Endes zeigt dem Autor ein Besuch bei der später ausfindig gemachten Halbschwester, die fürs ganze Leben von ihrem SS-Vater geprägt worden war, dass er nichts verloren, aber alles gewonnen hatte durch die Abwesenheit des Vaters. „Freiheit durch Verlust“, nennt Kaesler es.
Aber die Mutter? „Was wäre denn, wenn er plötzlich wieder käme?“, fragt der Sohn sie im Tonband-Interview. Und sie seufzt: „Ach, das wäre schön.“