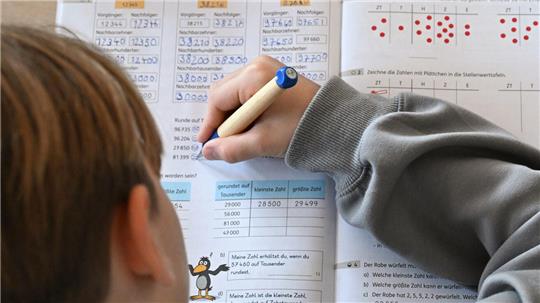Wo 500 Jahre Oberharzer Bergbaugeschichte schlummern

Noch nicht alles aus dem Bestand ist digital erfasst, wie das Rissarchiv der einstigen Preussag AG. Dr. Roxane Berwinkel und Christiane Tschubel sichten das Material. Fotos: Potthast
3500 laufende Meter Schriftgut mit mehr als 600 Bänden – in ihnen ein halbes Jahrtausend Bergbaugeschichte. Zu finden und nachzuvollziehen sind die im Bergarchiv Clausthal, einem Hort montanhistorischen Wissens. Die GZ stellt die Einrichtung vor.
Clausthal-Zellerfeld. Der Bau schlicht, der Inhalt hinter den mit Metall und Holz verkleideten Wänden wertvoll. Was Harzer Bergbehörden seit dem 16. Jahrhundert verschriftlicht haben, hat seinen Verwahrort im Bergarchiv Clausthal – ein Gebäude, das nach Plänen des weltbekannten Architekten Meinhard von Gerkan entworfen wurde (siehe Kasten). Es ist Außenstelle der Abteilung Hannover des Niedersächsischen Landesarchivs (NLA) und wird als „Überlieferungsort historischer Quellen zur Oberharzer Montangeschichte“ eingestuft.
Vier Stockwerke, 3500 laufende Meter Schriftgut mit mehr als 600 Bänden, bestehend aus Bergamts-Protokollen – sehr geschlossene Überlieferungen aus rund 500 Jahren Bergbau. So beschreiben Archivoberrätin Dr. Roxane Berwinkel und ihre Kollegin Christiane Tschubel den Umfang. Im Erdgeschoss dazu das erst kürzlich als Schenkung aufgenommene Rissarchiv der einstigen Preussag AG – Risse sind zeichnerische Darstellungen im Vermessungswesen des Bergbaus – inklusive der Betriebsakten von Bergwerken und Hüttenbetrieben sowie des Schriftguts der Markscheiderei – Markscheider legten Grenzen (Marken) verliehener Bergbauberechtigungen fest und trennten (schieden) dadurch konkurrierende Bergbautreibende (Quelle: Deutscher Markscheider-Verein).
Im Austausch
Das neue Material im Haus zwischengelagert, lässt derzeit einen Aufenthalt von Besuchern nicht zu. Archivalien, die nach wie vor bestellt werden können, sind einsehbar im Lesesaal der Abteilung Hannover des Niedersächsischen Landesarchivs. Zum Sommer soll aber im Clausthaler Meinhard-von-Gerkan-Bau ein Leseplatz frei sein, kündigen Dr. Roxane Berwinkel und Christiane Tschubel an, vor allem für die lokalen Forscher. Mit ihnen stehen sie im Austausch. „Stammnutzer geben uns auch schon mal Hinweise“, sagen sie. Wenn Angaben zu Archivalien verbessert oder korrigiert werden sollten. „Wir haben schon sehr spezialisierte Nutzer.“
Aber nicht nur die lokalhistorisch interessierten Einheimischen kämen, sondern auch Studenten, die für ihre Promotion auf Quellensuche seien, oder Vertreter des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), die Unterlagen zum Thema Sicherung von Bergschäden benötigten…
Sie zu betreuen – es soll nach Möglichkeit das herausgegeben werden, was tatsächlich gebraucht wird, um das Archiv nicht unnötig auszuheben –, gehöre zum Aufgabengebiet der Mitarbeiterinnen. Öffentlichkeitsarbeit ebenso: unter anderem über Beiträge in der Publikation des NLA-Magazins, über „Tage der offenen Tür“. Zudem böten sie Führungen durch das Gebäude an für neue Mitarbeiter des LBEG, Studenten der Technischen Universität Clausthal oder der Universität Göttingen… Auch Architekturstudenten seien schon zum Schauen da gewesen.

Preziosen, wie die Fremdenbücher der Grube Dorothea und des Tiefen Georg-Stollen, verbergen sich im Bergarchiv, das der Architekt Meinhard von Gerkan (gmp Architekten) entworfen hat. Es öffnet sich durch ein großes Fenster zum LBEG-Gebäude hin, zu dem auch inhaltlich eine Verbindung besteht.
Nicht nur Technisches über und zum Harzer Bergbau geben die Archivalien her, sondern auch Architektur- und Kulturhistorisches. Und wie werden sie geordnet? Nach den jeweiligen Behörden, in denen das Schriftgut entsteht, also nach dem Provenienz-Prinzip.
Eine der Kernaufgaben der Archivare sei der Kontakt zu den Bergbehörden und die Bewertung der auszusortierenden Betriebsakten. Das Ende des Oberharzer Bergbaus sei ja nicht das Ende der Bergbehörden gewesen, so Roxane Berwinkel. Denn die staatliche Aufsichtspflicht bleibe bestehen – nun im Hinblick auf die Sicherung der Anlagen, Gruben und Schächte. „Wir erschließen Archivgut, machen es nutzbar.“ Beachtenswert: In den montanhistorischen Unterlagen sei immerhin die bergbauliche Entwicklung im Oberharz nachzulesen.
Das Raum nehmende Rissarchiv übrigens wartet mit Wertvollem auf, unter anderem mit Karten und Rissen aus dem 17. sowie 18. Jahrhundert. Einer ist der Illingsche Riss von 1661, der die Gliederung Zellerfelds vor dem Stadtbrand im Jahr 1672 dokumentiert. „Für uns ist es immer wieder ein Erlebnis, sich die zu erschließen“, sagt Christiane Tschubel.
Der weitere Werdegang dieser und anderer historischer Papiere: Sie werden restauriert in der Bückeburger Werkstatt des LNA, dann digitalisiert – um die Originale künftig zu schonen – und sukzessive online gestellt. Das Archivinformationssystem „Arcinsys“ steht Archiv-Mitarbeitern und -Nutzern zur Verfügung. Eingepflegt werden sollen auch die etwa 8000 Dias von Dr. Wolfgang Lampe, Leiter des Bergarchivs von 2002 bis 2014, und seiner Mitstreiter. Ihr Thema: die Oberharzer Wasserwirtschaft. Die Aufnahmen von den Anlagen entstanden zwischen 1978 und 1984.
DAS GEBÄUDE:
Der international tätige Star-Architekt Meinhard von Gerkan, der im November 2022 verstarb, entwarf das neue Bergarchiv. Seine Idee zur Formgebung: ein rechtwinklig aufgeschlagenes Buch. Für die Fassadengestaltung wählte er Materialien, die einen Bezug zum Harzer Wald – Lärchenholz – und zum Bergbau – Blei – bilden. Der Bau ist überwiegend fensterlos, um die Archivalien vor klimatischen Schwankungen und UV-Strahlen zu schützen. Im dritten Geschoss öffnet er sich auf drei mal drei Meter und lässt unter anderem einen Blick auf das Altgebäude des einstigen Oberbergamtes – seit 2005 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) – zu. Im Juli 2000 wurde der Archiv-Neubau eingeweiht. Er soll zu seiner Entstehungszeit Lob und Tadel bekommen haben, wie in einem Artikel der GZ zu lesen ist. 2003 wurde er mit dem Preis vom Niedersächsischen Landesverband im Bund Deutscher Architekten (BDA) ausgezeichnet.
Quellen: www.gmp.de und GZ