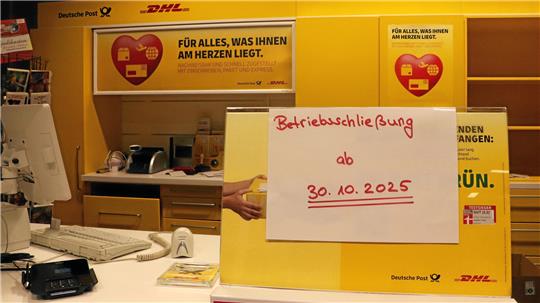500 Jahre evangelisches Gesangbuch: Feierstunde in Goslar

Für Elke Brummer, Vorsitzende des Fördervereins der Marktkirchenbibliothek, Helmut Liersch, Dr. Patrik Schnabel, Propst Thomas Gunkel, Landesbischof Dr. Christoph Meyns und Professor Johannes Lähnemann (v.l.) hat Marianne Kothé (2.v.r.) Sonderalben mit der Gedenkbriefmarke parat. Im Schaukasten ist das berühmte Gesangbuch zu bewundern. Fotos: Kleine
In der Marktkirche wurde jetzt die Sonderbriefmarke „500 Jahre Evangelisches Gesangbuch“ vorgestellt. Dabei konnten Besucher auch das originale „Ferbefaß-Enchiridion“ bestaunen, das älteste erhaltene Kirchengesangbuch der Welt.
Für nur 0,99 € alle Artikel auf goslarsche.de lesen
und im ersten Monat 9,00 € sparen!
Jetzt sichern!
Goslar. Ältestes Kirchengesangbuch der Welt, einziges Exemplar in Goslar, bibliophiler Schatz der Reformationsgeschichte: Mit der Feier zur Ausgabe der Sonderbriefmarke „500 Jahre evangelisches Gesangbuch“ markiert die Kaiserstadt abermals historische Superlative. Und das Fest in der Marktkirche hat auch noch viel Spaß gemacht.
Propst Thomas Gunkel, der evangelische Landesbischof Dr. Christoph Meyns, Oberbürgermeisterin Urte Schwerdtner und Dr. Patrick Schnabel, theologischer Referent des Rats der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), ließen mit ihren Ansprachen am Dienstagabend das älteste erhaltene Kirchengesangbuch hochleben. Und natürlich auch die Sonderbriefmarke, die das Bundesfinanzministerium zur Würdigung herausgegeben hat. Genauer gesagt: das „Sonderpostwertzeichen“, wie Gunkel charmant und schmunzelnd anmerkte.
Briefmarkendesign
Die prächtige Marktkirche verzeichnete zur Feierstunde in Goslar gleichermaßen prächtigen Besuch. Ob die Sondermarke zu Ehren des Gesangbüchleins ebenso prächtig ist, das bleibt ganz individuell den Betrachtern überlassen. Die Grafikerin Luzia Hein aus Hamburg erhielt von der „Jury“ in jedem Falle hohes Lob: Die Briefmarkengestaltung übersetze das bedeutende Thema zeitgemäß in Schrift und Form, machte Marianne Kothé deutlich. Sie ist Ministerialrätin im Bundesfinanzministerium und war zur Präsentation eigens nach Goslar gereist.
Es mag auch Stimmen geben, die ein Design aus in Strichen stilisierter Kirche, Gesangbuch und Notenblatt im farblichen Wechsel von grünen, taubenblauen, hellroten und ockerfarbenen Flächen nicht gerade als Blickfang empfinden. Doch angesichts der historischen Tragweite des Gesangbüchleins steht die zeitgenössische grafische Übersetzung auch nicht im Vordergrund – sondern das Postwertzeichen an sich.
2,5 Millionen Stück
Im Schnitt gehen jährlich rund 500 Vorschläge beim Finanzministerium ein, um Ereignisse, Dinge oder Menschen mit solchen Sondermarken zu würdigen, erklärte Kothé. Rund 50 davon werden pro Jahr verwirklicht. Dies läuft mit Gestaltungswettbewerben, über die am Ende ein künstlerischer Beirat und der Bundesfinanzminister höchstselbst entscheiden. Im Fall des evangelischen Gesangbuchs war es also Christian Lindner (FDP), der auch herzliche Grüße nach Goslar ausrichten ließ.

500 Jahre evangelisches Gesangbuch: Zur Feier in der Marktkirche gab es die Sondermarke auch mit Sonderstempel.
Eine Druckerei in Mönchengladbach hat das Sonderpostwertzeichen Anfang Januar schließlich auf den Weg gebracht – genauer gesagt: 2,5 Millionen Stück im Wert von jeweils 100 Cent. In Anerkennung ihrer Vorarbeit und ihrer Mitgestaltung der Feierstunde gab es am Dienstag einige Sonderalben aus der Hand der Ministerialrätin: an Propst Gunkel, die Festredner, aber auch an Kantor Gerald de Vries – sowie Sängerinnen und Sänger, die Originalliedern aus dem Gesangbuch wunderbar ihre musikalische Kraft verliehen.
Wie zu Luthers Zeiten
Inhaltliche Regie führte dabei Professor Johannes Lähnemann, der zusammen mit seiner Tochter – der Oxforder Professorin Henrike Lähnemann, eine prägnante wie lehrreiche Präsentation zum Enchiridion und seinen Liedern erarbeitet hatte. Von den insgesamt 25 Liedern im 500 Jahre alten Gesangbuch von 1524 stammen alleine 18 aus der Feder des Reformators Martin Luther.
Vielfach nutzten die Lieddichter damals Melodien bekannter Gassenhauer, um das Singen in der Kirche leichter und populär zu machen. Ein Trick, der sich wenig unterscheidet von Strategien mancher Hitlisten-Komponisten heute.
Der wirkliche Star des Tages stand am Dienstag in einer Vitrine neben dem Altarraum zunächst etwas im Abseits, doch immerhin war der Blick auf das originale „Ferbefaß-Enchiridion“ erleuchtet. Sein Name ist quasi Programm und verrät zugleich die Herkunft: Enchiridion bedeutet Handbuch, und das Gebäude, in dem es ehedem Johannes Loersfeld druckte, trug den Hausnamen „Zum Färbefass“.
Das Gebäude existiert bis heute, und aus der damaligen „Permentergasse“ ist die heutige Pergamentgasse in der thüringischen Landeshauptstadt geworden. So hat auch der markante Hinweis auf eine Nachbarschaft überdauert, in der früher Schriftkundige und Drucker ihrem Handwerk nachgingen.
An eine Kette gebunden
Helmut Liersch, Propst im Ruhestand und heute Wächter über die herausragende Marktkirchenbibliothek, machte das Schicksal des ersten evangelischen Gesangbuchs bei der Feier plastisch. „Von Halberstadt nach Goslar“ hieß sein Vortrag, der auch verdeutlichte, wie der Zufall manchmal so spielt, um Großartiges wieder zu entdecken.
Die schier kriminalistische Spurensuche ergab, dass das Gesangbüchlein aus der Bibliothek des Halberstädters Andreas Gronewald stammt, von der ein Teil im Jahre 1535 in Bücherfässern nach Goslar kam, schilderte Liersch. Ein Rostfleck auf dem Gesangbuch weist darauf hin, dass es ehedem an eine Kette gebunden war.
Für die wertvollen Bücher aus Halberstadt ließ die Gemeinde in Goslar damals eigens einen Anbau an die Marktkirche erschaffen. Ein weiterer Superlativ, wie Liersch an diesem Tag betonte: „Wir behaupten immer, der älteste reformatorische Bau der Welt.“