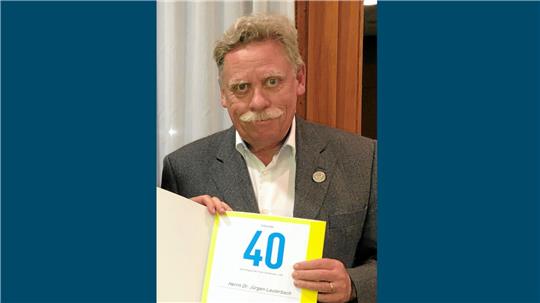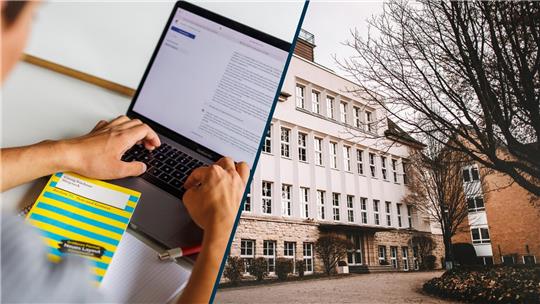Verloren im Rechts-links-Schema

Zahlreiche Menschen, darunter Teilnehmerinnen der Organisation „Omas gegen Rechts“, demonstrieren gegen Rechtsextremismus. Die Union hat eine Kleine Anfrage an das Bundesinnenministerium gestellt: Werden Nichtregierungsorganisationen (NGO) – von Globalisierungskritikern wie „Attac“ bis zu den „Omas gegen Rechts“ – aus staatlichen Steuermitteln gefördert? Foto: picture alliance/dpa
GZ-Chefredakteur Jörg Kleine analysiert das Rechts-Links-Schema: Verlieren CDU, SPD und Co. den Kompass im Parteien-Streit? Ist das Schema überholt, und wie orientieren sich Parteien in der „Mitte“?
Rechts, links, oben, unten – in diesen unruhigen Zeiten wissen auch die wählenden Zaungäste oft nicht mehr, wo sie sich auf dem politischen Spielfeld einordnen. Das bis in die 1990er Jahre probate Rechts-links-Schema zieht nicht mehr. Vorbei die Zeiten, in denen eine SPD mit Herbert Wehner einer CSU mit Franz Josef Strauß rechte Stimmungsmache vorwerfen konnte, die Christsozialen derweil mit dem Vorwurf linker sozialistischer Ideologie bei der SPD konterten. Das lief, ohne den jeweils anderen zu verdächtigen, nicht mehr auf dem Boden eines demokratischen Staatswesens zu stehen. Heute versammeln sich die Parteien alle gerne in der „Mitte“ – ohne die Frage zu beantworten, ob sich im geballten Spiel durch die Mitte auch die nötigen Tore erzielen lassen. Um das mal in der Fußballsprache zu umschreiben.
Das BSW ist ein Paradebeispiel dafür, sich beim alten Links-rechts-Schema zu verlieren. Im aktuellen politischen Raum-Zeit-Gefüge ist nur sicher, dass das Bündnis von Sahra Wagenknecht nach drei Landtagswahlen in Ostdeutschland schnell oben war – und nach der Bundestagswahl wieder ziemlich weit unten.
Trotzdem griff auch der in der Mitte verortete Kanzlerkandidat Friedrich Merz im Endspurt vor der Wahl nach wohlfeilen alten Metaphern: Bei der Abschlusskundgebung von CDU und CSU in München beschrieb er Demonstranten draußen als „grüne und linke Spinner“ – und verstieg sich zur rhetorischen Frage: „Wo waren sie denn, als Walter Lübcke in Kassel ermordet worden ist von einem Rechtsradikalen?“ Nun, nach dem widerlichen Mord 2019 am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke (CDU) waren Abertausende auf der Straße, um gegen Rechtsextremismus und Gewalt zu protestieren.
Bevor die Koalitionsverhandlungen mit der SPD überhaupt begonnen haben, bedient die Union mit 551 Fragen ans Bundesinnenministerium auch noch eine weitere Erzählung der rechtspopulistischen AfD: Die Demonstranten, die gegen eine von Merz heraufbeschworene Abstimmung zur Migrationsfrage im Bundestag wetterten, seien wohl von der rot-grünen Restregierung bezahlt worden. Im Klartext: Werden Nichtregierungsorganisationen (NGO) – von Globalisierungskritikern wie „Attac“ bis zu den „Omas gegen Rechts“ – aus staatlichen Steuermitteln gefördert? Oder einfacher: Warum dürfen Nichtregierungsorganisationen eigentlich gegen die CDU demonstrieren? Schon wittert der neue SPD-Chef Lars Klingbeil gemeinen Verrat und fordert die Union auf, vor Beginn von Koalitionsverhandlungen erst mal den Fragenkatalog zu NGO zurückzuziehen.
Auch viele politische Analysten haben auf diesem Spielfeld offenbar den Kompass verloren. So unterstreicht der Online-Chefkorrespondent des Magazins „Focus“, gemeinnützige Organisationen, die ja vom Staat begünstigt werden, hätten (partei)politisch neutral zu sein. Alles andere sei Veruntreuung von Steuergeldern. In der Vielzahl von NGO wittert der Kommentator gar „ein Paralleluniversum voller Widersprüche“.
Dabei ist es bei vielen Organisationen ja geradezu der Sinn, sich auch politisch zu engagieren. Das reicht von Lobbyvereinen über Sozialverbände und Gewerkschaften bis zu Parteistiftungen – und den Parteien selbst, die ja allesamt vom Staat begünstigt werden. Eine große staatlich geförderte Nichtregierungsorganisation sitzt übrigens stets im Parlament – und heißt Opposition.
Klingbeil und Merz tun also gut daran, Koalitionsgespräche nicht schon auf Nebenspielfeldern zu versemmeln.
Wie stehen Sie zu dem Thema?
Schreiben Sie mir:
joerg.kleine@goslarsche-zeitung.de