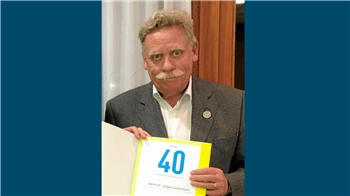Goslar: Von Brandkatastrophen nicht verschont

Dr. Ansgar Schanbacher spricht über die großen Brandkatastrophen in Goslar. Foto: Privat
Goslar erlebte im 18. Jahrhundert zwei Großbrände, die sich in das kulturelle Gedächtnis der Stadt intensiv eingeschrieben haben. Dr. Ansgar Schanbacher hat beim Geschichtsverein über die verheerenden Feuer berichtet.
Goslar. Die Entdeckung des Feuers war in der Entwicklung der Menschheit ein Meilenstein, vergleichbar vielleicht mit der Erfindung des Rades, der Schrift oder des Computers. Die Nutzung und zunehmende Beherrschung waren begleitet von Gefahren und Katastrophen. Nicht verwunderlich, dass Feuer auch in Mythen und Religionen von Bedeutung war. Goslar erlebte im 18. Jahrhundert zwei Großbrände, die sich in das kulturelle Gedächtnis der Stadt intensiv eingeschrieben haben. 1728 und erneut 1780 zerstörten Feuer hunderte Häuser, vor allem im Osten der Stadt, und hinterließen eine verletzte und verunsicherte Stadtgesellschaft. Ein Gemälde im Städtischen Museum vermittelt einen Eindruck vom Brand der Unterstadt. 237 von etwa 1070 Häuser fielen den Flammen 1780 zum Opfer.
Dr. Ansgar Schanbacher, promovierter Historiker und seit 2022 Mitarbeiter im Fachbereich Kultur der Stadt Goslar, referierte auf Einladung des Geschichtsvereins vor mehr als fünfzig Besucherinnen und Besuchern über Stadtbrände und Feuerschutz in Goslar.
Enge Bebauung
Dabei ging er über das 18. Jahrhundert und Goslar hinaus: Feuer war in mittelalterlichen Städten omnipräsent. Immer wieder kam es in Städten der Vormoderne mit ihrer engen Bebauung, feuergefährlichen Baustoffen wie Lehm und Holz und den offenen Feuern in den Häusern zu Brandkatastrophen.
Traurige Berühmtheit erlangte London: Kaum war die folgenschwerste Pestepidemie in Großbritannien vorbei, zerstörte der Große Brand von London im September 1666 rund vier Fünftel der Stadt. 100.000 Einwohner wurden obdachlos. Für Feuersbrünste gab es eine rationale weltliche Erklärung. Aus ihr wurden Schlussfolgerungen für die Verhütung gezogen. Und es gab eine religiöse Deutung als Strafmaßnahme Gottes. Für den Ausbruch von Stadtbränden, so der Referent, fanden sich immer wieder Gerüchte. Schuld am Großen Brand von London waren angeblich die Katholiken und eine Verschwörung des Papstes.
Zu den Maßnahmen, die städtische Obrigkeiten und die Bewohner europäischer Städte ergriffen, um mit der alltäglichen Feuergefahr umzugehen, gehörte in erster Linie der Erlass von Feuerordnungen, in denen detailliert Vorsorgemaßnahmen, das Verhalten bei Bränden und nach dem Abschluss der Löscharbeiten geregelt wurden. Derartige Ordnungen sind für Mitteleuropa bereits seit dem 15. Jahrhundert überliefert und für Goslar seit etwa 1640 archivalisch greifbar, zunächst in Form von Einzelregelungen, ab 1668 als erste Feuerordnung. 1640 wurde den Goslarer Zünften vorgeschrieben, dass 150 Löscheimer, 13 Feuerspritzen, 43 Leitern und 34 Feuerhaken bereitzuhalten seien; drei Wasserkünste dienten der Zuleitung von Wasser. Turm-, Tor- und Feuerwächter hatten auf etwaige Feuer zu achten. Im Goslarer Museum werden die bescheidenen Feuerlöschgeräte jener Zeit ausgestellt.
Schreckliche Bedrohung
Stadtbrände galten allerdings nicht nur als schreckliche Bedrohung für Menschen, Tiere und Gebäude. Sie waren ebenfalls ein Test für den Zusammenhalt einer Stadtgesellschaft und von Städten untereinander. An der Unterstützung durch die Bergleute am Rammelsberg scheint es 1780 gemangelt zu haben. Gleichzeitig werden aber überregionale Unterstützungsnetzwerke deutlich: Für den Wiederaufbau wurde in Goslar Geld gesammelt, aber auch in anderen Reichsstädten. Brandbriefe des Magistrats wurden deutschlandweit verschickt.16.000 Gulden sollen allein in Norddeutschland für den Wiederaufbau von St. Stephani nach 1728 gesammelt worden zu sein. Bis das Geld vor Ort ankam, konnte es mehrere Jahre dauern. Die Betroffenen kamen bis zum Wiederaufbau ihrer Häuser bei Verwandten unter oder mussten notdürftig kampieren.
Solidarität, Mitleid und Freiwilligkeit waren ausschlaggebend für die Spendenbereitschaft. Feuerversicherungen stellten die Schadensregulierung auf eine solidere ökonomische Basis. Goslar gelang es 1771, zeitweise in die Braunschweigische Feuerversicherung aufgenommen zu werden. Allerdings waren nicht alle Bürger versichert: Insbesondere die nichtversicherten Armen waren weiterhin im Schadensfall auf Spenden angewiesen. Der Großbrand von 1780 belastete die Feuerversicherungsgesellschaft derart, dass die Auszahlung an Bedingungen geknüpft und noch im gleichen Jahr die Versicherung gekündigt wurde.
Dem preußischen Organisationskommissar Christian von Dohm und dem Magistrat der Stadt Goslar war es ein dringendes Anliegen, Goslar (erneut) in eine Brandversicherungsanstalt aufnehmen zu lassen. Da die Stadt der Kriegs- und Domänenkammer Halberstadt unterstand, erfolgte 1803 die Brandversicherung Goslars bei der „Feuer-Sozietät der Städte des Fürstentums Halberstadt und der Grafschaft Hohnstein“. Nebenprodukt dieser Versicherung war der „Grund-Riß der ehemals Kayserlich freyen Reichs-, jetzt Königlich Preussischen Stadt Goslar“, der erste Plan der Stadt Goslar, der zugleich als Kataster der Feuerversicherung diente.