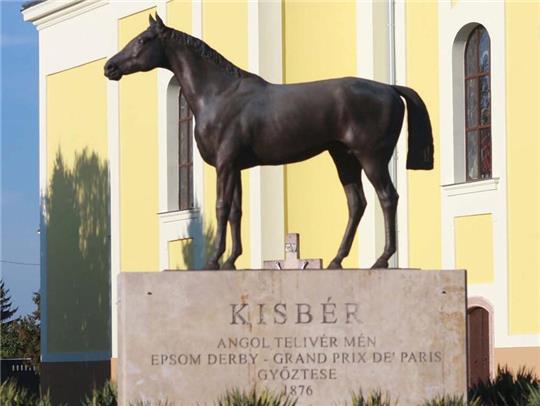Goslarer Geschichtsverein lädt zu Vorträgen in Herbst und Winter

Das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege führt seit 2019 Bodenuntersuchungen im Umfeld der Kaiserpfalz durch. Ein Vortrag am 9. Oktober befasst sich mit den Ergebnissen. Foto: Gleisberg (Archiv)
Um verschiedene Epochen der Stadtgeschichte und noch immer ungelöste Rätsel in Goslar geht es bei den Vorträgen des Goslarer Geschichtsvereins im Herbst und Winter. Acht spannende Abende warten auf die Teilnehmer.
Goslar. Von der frühen Stadtgeschichte bis in die Kriegszeit: Der Geschichtsverein Goslar hat sein neues Programm von September bis April vorgestellt. Die Vorträge finden jeweils an einem Donnerstag um 19.30 Uhr im Großen Sitzungssaal des Kreishauses statt. Organisiert wird die Vortragsreihe in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule. Die Teilnahme an den Vorträgen ist kostenfrei.
Quedlinburg im Mittelalter
Den Auftakt macht Professor Dr. Thomas Wozniak. Am 11. September lädt er zu seinem Vortrag: „Die Stadtwerdung von Quedlinburg im Mittelalter im regionalen Vergleich“. Warum wählte Heinrich I. ausgerechnet dieses kleine und unbedeutende Dorf am Nordrand des Harzes für seine zentrale Aufgabe der Verteidigung? Und welchen Einfluss hatte der jahrelange Familienstreit der Brüder Otto I. und Herzog Heinrich von Baiern auf die europäischen Entwicklungen im 10. Jahrhundert? Diese und viele weitere Fragen wird der gebürtige Quedlinburger während seines Vortrags beantworten. Er studierte Mittlere und Neuere Geschichte, Geografie und historische Hilfswissenschaften in Köln, wo er 2004 mit einer Arbeit über „Quedlinburg im 14. und 16. Jahrhundert“ promovierte.
Untersuchungen an der Pfalz
Weiter geht es am 9. Oktober, wenn Dr. Markus Blaich und Tobias Uhlig über das Thema: „Pfalz, Stift, Stadt – Neues aus der Bodendenkmalpflege in Goslar“ referieren. Das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege führt in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Goslar seit 2019 verschiedene Untersuchungen im Umfeld der Pfalz Goslar durch. Diese knüpfen an ältere Maßnahmen aus den 1970er Jahren an.
Dr. Markus Blaich studierte in Mainz, Marburg und Freiburg die Fächer Vor- und Frühgeschichte, klassische Archäologie, Alte Geschichte und Geografie. Tobias Uhlig studierte Ur- und Frühgeschichte und Geschichte in Göttingen. Das Studium schloss er 2021 mit seiner Promotion zu den Tierniederlegungen an der jungbronzezeitlichen Hünenburg bei Watenstedt im Landkreis Helmstedt ab.
Bergbau im Harz
„Grundlagen des Bergbaus – die Erz- und Minerallagerstätten des Harzes“ erläutert Dr. Klaus Stedingk am 6. November.
Der Harz und sein näheres Umfeld repräsentieren eines der reichsten Bergbaureviere Europas. Archäologische Untersuchungen geben immer wahrscheinlichere Hinweise für eine bronzezeitliche Metallgewinnung aus Harzer Erzen. Spätestens seit dem Mittelalter waren die Menschen hier über Jahrhunderte mit dem Schicksal des Montanwesens untrennbar verbunden.
Dr. Klaus Stedingk, geboren in Schulenburg/Leine, studierte an der Technischen Universität Clausthal Geologie mit den Schwerpunkten angewandte Geologie, Mineralogie, Lagerstättenkunde und Bergbau.
Geologie und die Geschichte des Hüttenwesens
Am Freitag, 14. November, um 15 Uhr, können gemeinsam mit Dr. Angnes Daub die Ausstellungen zur klassischen geologischen Quadratmeile und „Vom Erz zum Metall“ im Goslarer Museum besucht werden. Die Ausstellung vermittelt einen Eindruck von der geologischen Vielfalt des Goslarer Raumes, der seit Goethes und Humboldts Zeit als klassische geologische Quadratmeile bezeichnet wird. Goethe war fasziniert vom Harz und hat bei seinen Besuchen gezielt geologische Formationen aufgesucht. Mehr zur Geschichte des Hüttenwesens in der Region zeigt die Ausstellung im 2. Obergeschoss „Vom Erz zum Metall“.
Dr. Agnes-Margarete Daub hat in Bochum Biologie studiert und ihre Diplomarbeit und Dissertation am Lehrstuhl für Zellmorphologie über Untersuchungen zum Mechanismus der Zellteilung geschrieben. Sie ist dem naturwissenschaftlichen Verein Goslar 1995 beigetreten, wurde Schriftführerin und ist seit acht Jahren erste Vorsitzende des Vereins. Kosten für den Museumsbesuch trägt der Geschichtsverein für seine Mitglieder. Für Gäste fallen Kosten in Höhe von drei Euro an.
Hitler, Goslar und die NSDAP
Den nächsten Vortrag gibt es dann am 4. Dezember, wenn Frank Heine über das Thema: „Der nationale Kandidat heißt Hitler“, referiert. Was konnten die Menschen eigentlich über die NSDAP wissen, bevor Adolf Hitler ab Ende Januar 1933 an den Schaltstellen der Macht saß? Der Aufstieg der NSDAP in Goslar und das begleitende Echo in der Goslarschen Zeitung sind ein Thema, das der Referent Anfang der 1990er Jahre für seine Examensarbeit untersucht hat.
Frank Heine ist gebürtiger Goslarer und in Wolfshagen aufgewachsen. Sein Abitur hat er am Ratsgymnasium gemacht. Nach seinem Wehrdienst studierte er Geschichte und Latein auf Lehramt an der Georg-August-Universität in Göttingen. Seit April 1995 arbeitet er bei der Goslarschen Zeitung. Er absolvierte dort schon sein Volontariat und ist inzwischen Leiter der Lokalredaktionen Goslar und Nordharz sowie stellvertretender Chefredakteur.
Goslar in der Zeit des Barock
Dr. Ludwig Christian Bamberg startet am 22. Januar mit seinem Vortrag: „Barock in Goslar“ in das neue Vortragsjahr. Die Zeit des Barock ist nicht der künstlerische Schwerpunkt in der Geschichte der Stadt Goslar. Gleichwohl kann der Vortrag im Überblick beschreiben, wo sich doch im heutigen Stadtbereich Kunst des Barock findet.
Dr. Ludwig Christian Bamberg schloss sein Architekturstudium an der TU Berlin mit der Diplom-Prüfung und nach 40-jähriger Berufstätigkeit (davon 30 Jahre als Baudezernent des Landkreises Goslar) sein Kunstgeschichtsstudium an der FU Berlin mit dem Erwerb des Magister Artium ab.
Geheimnisse der Stadtgeschichte
Um „Die Villa Romana – ein Rätsel in der Geschichte Goslars“ geht es dann am 19. Februar bei einem Vortrag von Dr. Christina Wötzel. Die legendäre Ersterwähnung von Goslar für das Jahr 922 ist ein Hinweis erzählender Quellen auf 1100 Jahre Geschichte. Auch wenn diese Jahreszahl infrage zu stellen ist, bedeutet dies nicht, dass es zu dieser Zeit und davor auf dem Boden der späteren Stadt nichts gegeben hat, was siedlungsgeschichtlich relevant gewesen ist. Diesem „Nichts“ wendet sich der Vortrag zu. Und auch einem der letzten ungelösten Rätsel in der Stadtgeschichte: der Villa Romana. Die Goslarer Historikerin Dr. Christina Wötzel studierte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena Geschichte und promovierte dort 1985 zum Forschungsschwerpunkt Burgen und Landfrieden im 14. Jahrhundert in Thüringen.
Rückblick auf die Studienreise
Den Abschluss der Vorträge im Herbst und Winter machen Helgard Strube-Effenberger, Ulrich Koschorke und Heinrich Rohlof am 12. März. Sie beschäftigen sich mit dem Thema: „Altstädte, Umgebindehäuser, Sorben und Fürst Pückler: Rückblick auf die Studienreise 2025 in die Lausitz“. Nach dem Vortrag beginnt dann gegen 20 Uhr die Mitgliederversammlung des Geschichtsvereins.
Copyright © 2025 Goslarsche Zeitung | Weiterverwendung und -verbreitung nur mit Genehmigung.