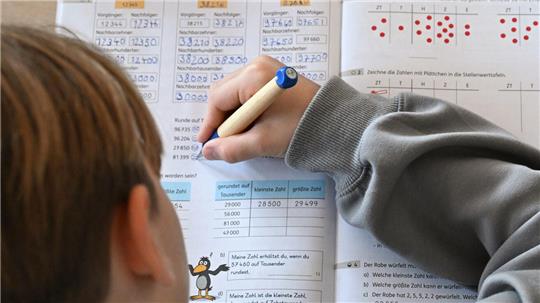Konstantin Kuhle: „Aus Solidarität muss planvolles Handeln werden“

Eine Frau aus der Region Donezk überquert nahe der Stadt Siret die Grenze zu Rumänien. Der FDP-Politiker Konstantin Kuhle warntdavor, das Ausmaß des russischen Angriffskriegs zu unterschätzen. Europa brauche bei der Flüchtlingsaufnahme einen gemeinsamen Plan. Foto: Armend Nimani/AFP
Konstantin Kuhle, Vize-Fraktionschef der FDP im Bundestag, fordert die zügige Registrierung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Er warnt vor einer Unterschätzung des Ausmaßes und der Dauer der Verteibung. Zudem zweifelt er an verschiedenen staatlichen Strukturen.
Braunschweig. Konstantin Kuhle (33) ist ein Kind dieser Region. Der FDP-Politiker wurde in Wolfenbüttel geboren, heute lebt er in Göttingen und hat dort seinen Wahlkreis. Als stellvertretender Fraktionschef seiner Partei im Bundestag sitzt er in den Bundestagsausschüssen Inneres und Heimat sowie Europa. Gremien, die sich mit den Folgen des Ukraine-Kriegs beschäftigen. Im Interview nimmt Kuhle Stellung zu einer künftigen europäischen Flüchtlingspolitik und auch zur Frage, wie gut Deutschland auf dem Feld des Katastrophenschutzes gewappnet ist.
Wir sehen eine große Hilfsbereitschaft überall in Europa. Eine Hilfsbereitschaft, die oftmals privat organisiert wird. Es ist gut und richtig, dass wir den Menschen jetzt unbürokratisch helfen. Ich habe nur die Sorge, dass wir das Ausmaß und die Dauer der Vertreibung im russischen Angriffskrieg unterschätzen. Wir müssen uns jetzt um die zügige Registrierung der Menschen kümmern, ansonsten ist auch ein schneller Zugang zum Arbeitsmarkt oder ein schneller Schulbesuch für die Vertriebenen gar nicht möglich. Es ist wichtig, dass der Staat einen Überblick über die Fluchtbewegung behält.
Aus der Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft muss jetzt ein dauerhafter Plan für die Unterbringung ukrainischer Vertriebener werden.
Man darf die Debatten nicht vermengen. Ich bin skeptisch, wenn versucht wird, die aktuelle Situation in der Ukraine zu nutzen, um die auf Eis liegende Neuregelung eines generellen EU-Asylsystems voranzutreiben. Auch lässt sich der Krieg in der Ukraine nicht mit der Situation in Syrien 2015 nicht vergleichen. Die EU hat die sogenannte Massenzustrom-Richtlinie aktiviert, sodass die Menschen kein aufwendiges Asylverfahren durchlaufen müssen. Außerdem können Menschen aus der Ukraine mit einem biometrischen Pass ohne Visum einreisen. Aber dennoch: Europa droht die größte Flüchtlingsbewegung seit Ende des Zweiten Weltkriegs, und es ist noch nicht absehbar, wann und ob die Menschen wieder zurückkehren können. Daher braucht es eine Verteilung der Flüchtlinge innerhalb der EU, aber auch darüber hinaus, um die Anrainer-Staaten wie beispielsweise die Republik Moldau zu entlasten. Richtig bleibt weiterhin: Alle Europäer sitzen in einem Boot und müssen solidarisch sein – mit anderen, aber auch untereinander.
Dieser Mut, sich gegen die Repressionen des Systems zu stellen, ist bewundernswert. Daher müssen Deutschland und die EU kommunizieren, dass der Schutz von Flüchtlingen nichts mit dem Pass zu tun hat, den ein Mensch besitzt, sondern, ob dieser einer individuellen Verfolgung ausgesetzt ist. Dieses Recht, das das Asylverfahren regelt, muss natürlich auch für russische Staatsbürger gelten.
Die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Herkunft ist mit nichts zu rechtfertigen. Allerdings möchte ich auch mal klarstellen, dass nicht jede Kritik oder kritische Nachfrage zur Politik Putins als Russenfeindlichkeit bezeichnet werden darf. Diese Erzählung wird seit Jahren, insbesondere von den in Deutschland agierenden russischen Staatsmedien, betrieben.
Das Dilemma einer liberalen Demokratie ist ja gerade, dass wir diese Freiheit bieten, die in autoritären Systemen nicht besteht. Gleichzeitig nutzt ein Regime wie das russische diese Freiheit, um unsere offene Gesellschaft zu untergraben. Und genau an dieser Stelle muss unsere Demokratie wachsamer sein. Deswegen finde ich es richtig, dass die EU Propaganda-Schleudern wie „Russia Today“ oder „Sputnik“ den Betrieb untersagt hat. Ich halte das jetzt für verhältnismäßig.
Aber auch wir müssen unsere strategische Kommunikation anders ausrichten. Ein gutes Beispiel ist die Rede von Kanzler Olaf Scholz bei der Sondersitzung des Bundestags, in der die gesamte Neuausrichtung der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik ein Thema war. Am nächsten Tag war sie auf der Internetseite des Bundestags auf Russisch und Ukrainisch nachzulesen. Diese kommunikative Öffnung ist wichtig.
Die Pandemie, die Bewältigung des Klimawandels und jetzt auch der Krieg in der Ukraine sind Beispiele dafür, dass wir einen besseren Katastrophenschutz benötigen. Dieser ist bislang von einer starken Rolle der Kommunen und Landkreise sowie durch ehrenamtliches Engagement geprägt. Vor allem das Ehrenamt ist aus dem Katastrophenschutz nicht wegzudenken, denn damit ist das Thema in den Köpfen der Menschen präsent. Doch, ob die verschiedenen staatlichen Strukturen zukunftsweisend sind, daran habe ich meine Zweifel.
Schwere Naturkatastrophen, pandemische Viruserkrankungen und die Vertreibung von Millionen Menschen durch einen Krieg in Europa machen nicht an einer Landkreisgrenze halt. Bund, Länder und Kommunen müssen die die Organisation des Katastrophen- und Zivilschutzes ins 21. Jahrhundert bringen. Das bedeutet konkret, dass das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) mit einer Zentralstellenfunktion ausgestattet werden muss, um eine stärkere Koordinierung durch den Bund möglich zu machen.
Ja, wenn uns Praktiker beschreiben, dass im Katastrophenfall die Abstimmung nicht funktioniert, das benötigte Material nicht da landet, wo es gebraucht wird, weil keine Kenntnis darüber besteht, wo sich Güter oder Gerätschaften befinden und Hilfsangebote, die oftmals aus der Bevölkerung kommen, nicht koordiniert werden können, dann muss man grundsätzlich die Frage stellen, wie wir Bürokratie abbauen können. Der Bund sollte eine stärkere koordinierende Rolle einnehmen. Er kann auch dafür sorgen, dass die Fähigkeiten in Ländern und Kommunen verbessert werden.
Der Bund könnte in den Ländern und Kommunen ein Angebot verpflichtender Fortbildungen für Krisensituationen machen. Und wir sollten, bei allem Respekt für den Föderalismus in Deutschland, auch für uns klären, an welchen Stellen die Trennung zwischen Bevölkerungsschutz und Zivilschutz nicht eine künstliche ist. Hier sollten wir Synergien schaffen und das Aufrechthalten doppelter Strukturen beenden. Auch das Thema der Hilfe für die Flüchtlinge ist ein gutes Beispiel dafür.
Wir sehen bei der aktuellen Flüchtlingshilfe viel Engagement von Organisationen, die im Katastrophenschutz tätig sind. Und gleichzeitig entspringt dieser Strom an Vertriebenen einer kriegerischen Auseinandersetzung, für deren Bewältigung der Bund zuständig ist. Ich sehe hier zumindest einen organisatorischen Widerspruch.
Der Bundeskanzler hat das sehr gut mit dem Begriff der Zeitenwende beschrieben. Das umfasst auch die besondere Verantwortung, die man als Parlamentarier hat. Und gleichzeitig ist das schon eine große Belastung, wenn man als Mitglied einer neuen Bundesregierung angetreten ist, um Reformen auf den Weg zu bringen und den Stillstand aufzulösen und gleichzeitig erstmal ausschließlich Krisenbewältigung machen muss. Wer in die Politik geht, weiß aber, dass man sich die Zeit, in der man das tut, nicht aussuchen kann.
Liberale Demokratien haben den Vorteil, dass man sich auch in Krisenzeiten mit der Reform des Staatswesens befassen kann. Natürlich frisst eine Krise wie der Krieg in der Ukraine im politischen Betrieb viele Kapazitäten, aber sie offenbart auch Anknüpfungspunkte zu anderen wichtigen Themen. Ich war in den Koalitionsgesprächen mit Grünen und SPD in der Verhandlungsgruppe, die sich um die Planungsbeschleunigung gekümmert hat, bei der es ja in Deutschland gewaltig hakt. Schauen Sie sich hier einmal die Frage der Energiesicherheit an. Die war schon von enormer Bedeutung, als es um den Umbau der deutschen Wirtschaft hin zu mehr Klimaneutralität ging. Sie ist jetzt mit Blick auf die Abhängigkeit vom russischen Gas noch dringlicher geworden. Die Verfahren zu beschleunigen, um beispielsweise schneller Windkrafträder aufzustellen, würde uns hier voranbringen. Krisen wirken immer wie ein Brennglas auf Missstände der Gesellschaft und sind auch eine Chance für Veränderungen. Da macht der Krieg keine Ausnahme.
von Dirk Breyvogel, Funke Mediengruppe.

Konstantin Kuhle ist seit Dezember 2021 stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP im Deutschen Bundestag. Foto: Tjark Thönßen/FDP