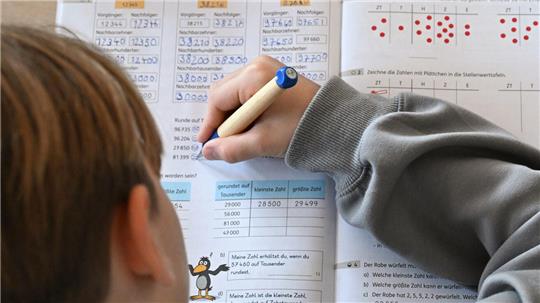Häusliche Gewalt: Wie Opfer sich wehren können

Foto: dpa
Beleidigungen, Drohungen und Überwachung im Netz: Die Digitalisierung führt zu neuen Phänomen der häuslichen Gewalt. Katrin Heiland, Oberamtsanwältin in der Braunschweiger Staatsanwaltschaft, engagiert sich seit Jahren für die Eindämmung häuslicher Gewalt.
Heimliche Überwachung, Stalking, Beleidigungen, Bedrohungen und Verleumdungen über soziale Medien – im digitalen Zeitalter sehen sich Strafverfolger neuen Phänomenen auch der häuslichen Gewalt gegenüber. Katrin Heiland, Oberamtsanwältin in der Braunschweiger Staatsanwaltschaft, engagiert sich seit Jahren für die Eindämmung häuslicher Gewalt durch gute Hilfsstrukturen in der Region. Zuletzt hat sie eine Fachtagung der Generalstaatsanwaltschaft und der Polizeidirektion Braunschweig zur Bekämpfung häuslicher Gewalt mitorganisiert. Ein Thema: Wie können sich Opfer vor digitaler Gewalt schützen?
Frau Heiland, häusliche Gewalt scheint glücklicherweise kein Tabu-Thema mehr zu sein. Spiegelt sich das in Ihrer Arbeit?
Gingen bei der Braunschweiger Staatsanwaltschaft in den vier Sonderdezernaten für häusliche Gewalt im Jahr 2010 rund 1000 Verfahren ein, waren es 2021 schon 2500. Das bedeutet aber nicht, dass es mehr häusliche Gewalt gibt. Es werden mehr Straftaten angezeigt.
Neue Formen dieser Gewalt alarmieren die Strafverfolger.
Die Opfer werden in ihrer Lebensführung zuweilen massiv eingeschränkt. Die Phänomene reichen von der Beleidigung bis zur Bedrohung oder Überwachung. Da wird zum Beispiel nach einer Trennung gedroht, intime Fotos im Internet öffentlich zu machen, wenn die Frau nicht zum Mann zurückkehrt. Oder über die Opfer wird in Sozialen Medien schlecht geredet. Dann heißt es etwa: Die misshandelt ihre Kinder oder ihre Tiere. Oder sie arbeitet schwarz.
Wie überwachen Täter ihre Opfer?
Zum Beispiel durch Spy-Software auf dem Handy ergeben sich für Täter neue Möglichkeiten. Irgendwann merken die Opfer, dass zum Beispiel der Ex-Freund immer genau dort auftaucht, wo sie sich gerade befinden. Das ist ein schleichender Prozess. Anfangs wundern sie sich darüber, dann merken sie, dass das kein Zufall sein kann. Teilweise kommt es auch zu bedrohlichen Situationen oder Gewalt. Das bloße Auftauchen an Orten, wo sich zum Beispiel die Ex-Partnerin aufhält, ist allerdings noch keine Straftat – es sei denn, es besteht ein Näherungsverbot nach dem Gewaltschutzgesetz.
Aber wenn Täter heimlich Überwachungssoftware auf das Handy der Partnerin oder Ex-Partnerin installieren, um sie so jederzeit orten zu können, machen sie sich doch strafbar?
Ja, aber das zu ermitteln ist mühsame Arbeit. Die Opfer müssen der Polizei dazu auch ihr Handy zur Auswertung der Daten überlassen. Die Software kann auf Handys gut versteckt werden, so dass sie schwer auffindbar ist. Voraussetzung ist, dass der Täter einmal unbemerkt Zugriff aufs Handy seines Opfers hatte.
Was bezwecken Täter damit?
Kontrollwahn ist ein typisches Phänomen innerhalb der Gewaltspirale. Männer schränken die Kontakte ihrer Partnerinnen immer stärker ein, am Ende wird ihr gesamtes soziales Umfeld schlecht gemacht und die Frau vollständig isoliert. Das Handy wird ebenfalls kontrolliert. Dann heißt es: „Warum hast du jetzt mit dem geschrieben?“ Auch nach einer Trennung wollen solche Täter oft die Kontrolle behalten.
Wie können sich Opfer dagegen wehren?
Die Erfahrung zeigt: Strafanzeigen können Täter stoppen. Wir raten zur frühzeitigen Anzeige und positionieren uns: Bei häuslicher Gewalt gibt es keine Bagatelldelikte, ob es sich um Beleidigungen oder Hausfriedensbruch handelt. Auch das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Werden die Grenzen des guten Tons überschritten, kann das angezeigt werden. Wichtig ist, dass die Opfer alle Beweise sichern, also auch digitale Daten wie zum Beispiel Chatverläufe mit beleidigenden Nachrichten. Oder dass sie Screenshots davon erstellen. Die Beleidigung ist ein absolutes Antragsdelikt, das heißt, die Tat wird nur auf Antrag des Geschädigten verfolgt. Die Strafantragsfrist beträgt drei Monate ab Kenntnis von Täter und Tat, es sollte also auch nicht zu lange gewartet werden.
Mit welchen Konsequenzen haben Täter oder auch Täterinnen zu rechnen?
Die Beleidigung ist oft das Einstiegsdelikt in eine Gewaltspirale. Für die erste Beleidigung gibt es 20 bis 30 Tagessätze Geldstrafe, und wenn es nicht aufhört, setzt sich auch in der Justiz die Spirale in Gang: von immer höheren Geldstrafen bis hin zur Freiheitsstrafe mit und ohne Bewährung. Bei schnell aufeinander folgenden Taten kann es also auch relativ schnell zu einem Gefängnisaufenthalt kommen.
Abgesehen von einer Strafanzeige – was können Opfer noch tun, um sich gegen digitale Gewalt etwa durch Ex-Partner zu wehren?
Zum einen: Will ich nach einer von Gewalt geprägten Beziehung wirklich keinen Kontakt mehr haben, sollte ich niemals auf den Ex-Partner reagieren und mich auch nicht etwa auf eine „letzte Aussprache“ einlassen.
Das Kontakthalten kann die Anfangsstufe vom Stalking sein. Der Täter will die Kontrolle behalten. Darüber hinaus ist Zurückhaltung die bessere Variante: Wenn mein Partner oder Ex-Partner mich beschimpft und beleidigt, macht er sich strafbar. Ich sollte es ihm aber nicht mit gleichen Mitteln heimzahlen. Bei Beleidigungen gibt es keine Notwehr. Besser ist es, die Telefonnummer zu blockieren, auf unbekannte Nummern nicht zu reagieren und auch nicht gerade bei Facebook die neuesten Fotos über die Aufenthaltsorte zu posten. Zum anderen kann das umfassende Beratungsangebot in Anspruch genommen werden. Zum Beispiel die Frauenberatungsstellen helfen schnell und unbürokratisch. Es können auch Anträge nach dem Gewaltschutzgesetz gestellt werden.
Paare wollen sich auch in Beziehungen, in denen es zu häuslicher Gewalt gekommen ist, nicht immer trennen. Wie gehen Sie damit um?
Es ist nicht Aufgabe der Staatsanwaltschaft, den Beziehungsstatus zu bewerten. Wir verfolgen Straftaten. Wir beauftragen in Verfahren häuslicher Gewalt in der Regel den Ambulanten Justizsozialdienst mit einem Täter-Opfer-Ausgleich. In solchen Gesprächen geht es um Möglichkeiten der Einigung zwischen den beteiligten Personen und Vermeidung zukünftiger Straftaten. Es werden zusätzlich Hilfsangebote und Alternativen aufgezeigt. In anderen Fällen erhält der Täter eine Geldauflage, die er an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen muss.
Seit einiger Zeit gibt es in Braunschweig und der Region auch Täterberatungsstellen. Die Täterberatung setzt auf Verhaltensänderungen. In sechsmonatigen Kursen setzen sich Gewalttäter mit ihren Taten auseinander, Gewaltmuster sollen erkannt und durchbrochen werden. In wie vielen Fällen kommt es zu einer Beratung?
Unsere Region ist mit Täterberatungsstellen recht gut abgedeckt. Einziger weißer Fleck ist die Harzregion, rund um den Landkreis Goslar. Insgesamt gehen bei der Braunschweiger Staatsanwaltschaft jährlich rund 2500 Verfahren wegen häuslicher Gewalt ein, etwa 2000 davon bearbeitet die Amtsanwaltschaft, von denen wiederum 60 Prozent auf meinem Schreibtisch landen. In 10 bis 15 Fällen erteile ich die Auflage, am Kurs der Täterberatungsstelle teilzunehmen. Täterarbeit ist aktiver Opferschutz.
Das ist ein relativ geringer Anteil.
Die Minimalanforderung, um das eigene Fehlverhalten reflektieren zu können, ist die Akzeptanz der Tat und die Einsicht ins eigene Unrecht. Die aber fehlt bei den meisten Tätern leider. Ein Geständnis ist bei häuslicher Gewalt eher die Ausnahme. Stattdessen heißt es, sie hätten nichts gemacht, das Opfer sei selbst schuld oder habe sich selbst verletzt. Ein weiteres großes Hindernis für eine Teilnahme am Kurs der Täterberatung sind fehlende deutsche Sprachkenntnisse. Es gibt aktuell auch kein Angebot für Täterinnen.
Vor 20 Jahren trat in Deutschland das Gewaltschutzgesetz in Kraft, das es Opfern ermöglicht, den Täter etwa aus der gemeinsamen Wohnung verweisen zu lassen und ihm ein gerichtliches Näherungsverbot aufzuerlegen.
Neben einer Strafanzeige sollten Opfer konsequent alle staatlichen Hilfen in Anspruch nehmen, auch das Gewaltschutzgesetz, und jeden Verstoß dagegen konsequent melden. Das erfordert viel vom Opfer, aber sonst hört der Täter womöglich nicht auf. Von Bettina Thoenes, Funke Medien Gruppe