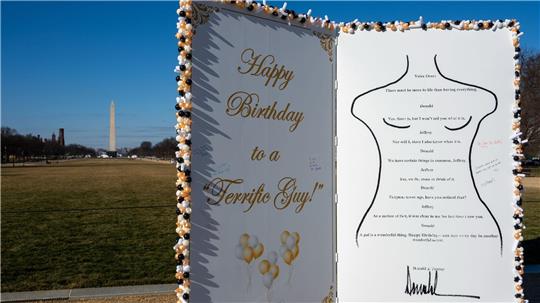Documenta: Wenn die Bienen mitentscheiden

Vom kenianischen Wajukuu Art Project stammt diese Installation auf der documenta.
Die „documenta fifteen“ führt Kollektive im Dienste von Ökologie und Solidarität zusammen und verlangt vom Publikum Einarbeitung.
Dass man einfach so durch die Säle streift und auf sorgsam gehängten Bildern die wesentlichen Stimmen und Stimmungen einer Welt pointiert ausgedrückt findet, so einfach geht Kunst ja schon lange nicht mehr. Und Documenta schon gar nicht. Der alte Streit um reine oder engagierte Kunst ist längst entschieden. Ohne weitgreifenden gesellschaftlichen Anspruch und zunehmend auch direkt eingreifendes Engagement ist Kunst nicht mehr zu haben.
Das hat Konsequenzen für die Kasseler Weltkunstschau, denn das Eigentliche liegt manchmal weit weg und trägt ein in den „Lumbung“, den vielzitierten Reisspeicher künstlerisch-sozialen Gemeinschaftssinns, den das Leitungsteam als Sinn allen Kunstschaffens ausgegeben hat. Zu sehen sind an der Fulda daher oft nur Stellwände mit Slogans, Protokollen und Alltagsobjekten, die von den kollektiven Projekten künden. Freilich allseits auch Videoschirme, QR-Codes, Internetstationen, mittels derer man sich in die Ansätze einarbeiten kann. Und alte Sessel und Sofas, um darüber zu diskutieren.
Jeder ein Kurator
Die Abteilung Afrika grüßt mit einem Welcome-Fußabtreter. Videobilder aus dem Busch atmen die Weite dieses Kontinents. „Wie groß ist dein Feld? – Wenn ich müde bin weiterzugehen, hört es auf“, sagt ein Schwarzer. Unter einem kuppelartigen Dach, das an einen Kral erinnert, erzählt ein anderer von den Menschen, die aus allen Himmelsrichtungen in seinem Dorf zusammenkommen. Er fertigt wie ein Schmied kleine Metallkreuze, die das symbolisieren. Kunst, die zum Überleben reicht? Man ertappt sich in seinem europäischen Dünkel, ob der Kral, die Handarbeit nicht doch etwas klischeehaft-folkloristische Zitate sind. Und laden wir mit unseren ökologisch-kollektiven Kunstprojekten nicht wiederum den indigenen Völkern die Rettung der Welt auf, die wir selbst, obwohl seit Jahrzehnten um Klimawandel und mögliche Gegenmaßnahmen wissend, nicht zustandebringen?
Wenn es mir trotz zunehmenden Hitzesommern nicht gelingt, die alten Bäume vor meinem Haus zu retten, die Versieglung ganzer Landschaften zu verhindern, weil der westliche Wohlstand immer vorgeht, wieso erwarte ich es von Afrika? Neben dem Industriekolonialismus Chinas gibt es eben auch gutgemeinten Ökokolonialismus.
Zu Recht würden die afrikanischen Künstlerkollektive einwenden, dass sie aus Einsicht handeln, nicht um Europa einen Gefallen zu tun. Dass sie ihre indigene Kunst bewahren, wiedererobern, weiterentwickeln wollen, unabhängig davon, was (europäische) Kuratoren davon denken. Sie sind jetzt selbst „Kirata“ (Kuratoren). Und wenn man die herzhafte Kongolesin im Film erlebt, die ihren Gemeinschaftswald künftig mit sehr direkter Ansprache der Ökosünder verteidigen will, dann schöpft man vor dem Hintergrund langer matriarchalischer Traditionen in Afrika Mut.
Inspirationen
Und, ist das Kunst? Vielleicht keine, die ins Museum kommt. Aber eine, die wirkt und zusammenführt. Im direkten Austausch vor Ort in Kassel, oder im Internetarchiv, wo sich die Projekte gegenseitig inspirieren können. Während der europäische Bummler über die „documenta fifteen“ vielleicht etwas kennerhaft die Nase rümpft, ist es rührend zu sehen, welche Bedeutung die außereuropäischen Kollektive dieser Weltkunstschau beimessen. In ihren eigenen Ländern oft genug umstritten oder gar verfolgt, äußern sie in Filmen, wie die Idee des Lumbung-Netzes sie trägt, so das Wajukuu Art Project in den Slums von Nairobi. Ihre großartigen Objekte in der Documenta-Ausstellungshalle betritt man durch einen Tunnel aus Wellblech, aus dem auch ihre Siedlungen gebaut sind. Sie sind ständig bedroht von Bulldozern oder Überschwemmungen.
Weiße Lügen wirken
Drei große Skulpturen aus Fundmaterial ergeben eine nun allerdings museumswürdige Installation: Eine Art Bettgestell mit gespannten Riemen, das an Folterbetten oder das Gitter erinnert, auf dem der Heilige Laurentius verbrannt wurde. In der nächste Skulptur schweben zwei Schwarze in einem weltkugelrunden Kokon und lassen Bänder aus Tränen und Blut in die glühende Asche darunter fallen, ein Bild, das konkret wie im allgemein weltklimatischen Sinn funktioniert. Die letzte Skulptur sind Wände aus Messern, was das Aushilfsmetier der Slumbewohner ebenso aufgreift wie die ständige Aggression in den Siedlungen und der (Staats)Macht gegenüber den Siedlungen und ihren Menschen.
Es ist sicher kein Zufall, dass eins der wenigen traditionell gehängten Bilder der Documenta weiß in weiß gemalt ist und unter dieser schimmernd reinen Fassade den Spruch „White Lies Matter“ erkennen lässt: weiße Lügen wirken. Dabei versuchen sich natürlich auch die europäischen Künstlerkollektive den alten Strukturen zu entziehen. Da umschwirren einen im Ruru-Haus in einer schwarzen Soundinstallation die Bienen, die als ökologischer Indikator und grüne Sympathieträgerinnen schon Wahlen entschieden haben. Im angeschlossenen Projekt bekommen sie bei Abstimmungen über Lebensraum und Haushalt Mitspracherecht. 15 Bienenvölker sind so an der Zukunftsgestaltung von Welt beteiligt, ihr Flug- und Flächennutzungsverhalten etwa könnte beeinflussen, wann wo welcher Verkehr fließt, Wiesen und Bäume geschützt werden. Sollte man auf Stimmrecht für Bäume ab 18 Jahren ausweiten! Auch da ließe sich ganz klar evaluieren, was sie in ein Gemeinwesen einbringen.
Aber natürlich haben die Menschen auch untereinander noch allerhand zu regeln. Das nach der jüdischen Philosophin Hannah Arendt benannte Instituto di Artivismo befasst sich mit der Zensur und Verfolgung von Künstlern in Kuba, ausgehend von einer hunderttägigen öffentlichen Lesung ihrer Schrift „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaften“. In der Installation dazu tragen die Pfähle eines Labyrinthes Stoffhauben mit den Gesichtern Verfolgter.
Schöpfungsmythos
Im Fridericianum zeigen algerische Frauen Dokumente der Unterdrückung der Frauen in ihrem Land, kann man die klischeehafte Darstellung von Schwarzen im und nach dem Kolonialzeitalter studieren (bis hin zum „Sarotti-Mohr“), werden die Agitprop-Bilder von Richard Bell für die Rechte der Aborigines ausgestellt: „Warum sollen wir für unser eigenes Land zahlen?“
Dass die Darstellung der Kulturgeschichte verfolgter Völker auch nicht einfach ist, zeigt das Projekt eines Roma-Moma, eines zeitgenössische Museums für Roma-Kunst, das die Off-Biennale Budapest beisteuert. In Kassel ist der raumhohe vierteilige Schöpfungsmythos der Roma von Tamás Péli zu sehen, das er 1983 im Refektorium der „Stadt der Kinder“ im Andrássy-Schloss installierte, ein Schlüsselwerk der Roma-Bewegung im kommunistischen Ungarn. Und doch heute wieder umstritten wegen seiner „dominanten Maskulinität“.
Die klischeegemäß männliche Clanstruktur der Roma konterkariert Malgorzata Mirga-Tas in ihrer Serie „Out of Egypt“ 2021 sehr bewusst. Ihre Textilcollage zeigt Bilder aus dem Roma-Leben, beides durchaus ironisch, das Frauenmetier Textiles wie der romantische Blick von Nicht-Roma-Künstlern werden in Collage und Thematik durchbrochen. Bei ihr sind die Frauen die Handelnden.
Ein Tipp für heiße Tage: Im kühlen Ottoneum führt eine Videoinstallation in den Dschungel Südkoreas und Palaus, wo unter üppiger Vegetation Militäranlagen von vergangenen Kriegen Japans und Amerikas künden, Reste von Ananas-Plantagen und Phosphorfabriken von Ausbeutungen erzählen, die sich im hochindustrialisierten Südkorea auf andere Art fortsetzen.
Von da geht’s die Fulda entlang zum Festungsturm Rondell, das oben einen Biergarten mit Aussicht bietet, im Keller eine mystische Installation des Vietnamesen Nguyen Trinh Thi über den verlockenden Duft des heimischen Chilibaums, der einst einen Aufstand in einem kommunistischen Umerziehungslager auslöste. Schon gruselig.
Auch die Karlsaue bietet immer wieder spannende Stationen, von den singenden Bäumen zerstörter Wälder Kolumbiens über den Nepp der Altkleiderspenden bis zum lebenden Komposthaufen. Kunst zum Erwandern, tut gut.
Von Andreas Berger, Funke Medien Gruppe