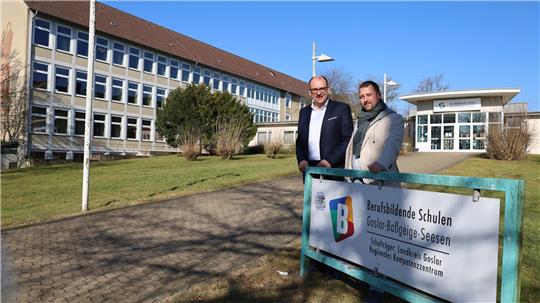Videospiele: Wann muss ich mir Sorgen machen?

Ein 8-jähriger Junge spielt auf dem Bett ein Videospiel auf einer mobilen Spielekonsole in seinem Zimmer. Foto: picture alliance/dpa/Europa Press | Eduardo Parra
Playstation, Nintendo Switch oder am PC: Viele Kinder stürzen sich in virtuelle Welten. Eltern sind schnell genervt vom Zocken ihrer Sprösslinge und wissen oft gar nicht, wie altersgerecht diese Spiele sind und wie sie mit ihren Kids darüber sprechen können.
Eltern kennen das: Wie gebannt sitzt das eigene Kind vor dem Bildschirm, lässt sich aus dem Alltag entführen in virtuelle Welten. Sohn oder Tochter stürzen sich in fesselnde Abenteuer, epische Schlachten oder spielerische Herausforderungen – allein oder zeitgleich mit Freunden übers Internet. Millionen Kinder und Jugendliche leben ihre Leidenschaft am Smartphone, der Konsole oder dem PC aus – Eltern sind schnell genervt vom pausenlosen Daddeln ihrer Kinder. Dabei wissen längst nicht alle Mütter und Väter, wie altersgerecht das ist, was ihre Heranwachsenden da spielen, was den Reiz am Zocken ausmacht und wie sie mit ihren Kindern darüber ins Gespräch kommen können.
In dieser Woche trifft sich die Videospielbranche auf der Gamescom in Köln, der weltgrößten Videospielmesse. Über 260.000 Besucherinnen und Besucher treffen auf über 1000 Aussteller und können in den Hallen Neuheiten auf dem Spielemarkt erleben. Millionen Fans verfolgen die Gamescom übers Internet – ein Massenphänomen.
Drei Dauerbrenner
Über die Hälfte der Deutschen ab 16 Jahren (53 Prozent) spielen laut dem Digitalverband Bitkom zumindest hin und wieder. Jugendliche zocken unter der Woche nach eigenen Angaben durchschnittlich 109 Minuten am Tag – Jungen (130 Minuten) deutlich länger als Mädchen (87 Minuten). Das zeigt die JIM-Studie für 2022 des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest, der den Medienumgang der 12- bis 19-Jährigen untersucht.
Abgefragt wird dort auch, welche Spiele bei den Jugendlichen besonders hoch im Kurs stehen. Auf den ersten drei Plätzen landeten vergangenes Jahr erneut drei millionenfach verkaufte Dauerbrenner: das Aufbauspiel „Minecraft“ mit 19 Prozent vor der Fußballsimulation „Fifa“ (18 Prozent) und dem Online-Überlebens-Shooter „Fortnite“ (zwölf Prozent). Was reizt Kinder und Jugendliche an diesen Games? Und wie kindgerecht sind diese aus Sicht der zuständigen Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK)?
„Minecraft“ (USK ab 6 Jahren)
Das Aufbauspiel ist das weltweit am häufigsten verkaufte Videospiel aller Zeiten mit knapp 240 Millionen Stück. Die Spieler und Spielerinnen können darin in Klötzchen-Optik ihre eigene Welt gestalten, Gegenstände herstellen und ihre Spielfigur verbessern. Grundsätzlich sehen Experten „Minecraft“ als geeignet für Kinder ab 6 Jahren. Für Jüngere kritisch bewertet wird aber der Überlebens- und Hardcore-Modus, der – anders als der harmlose Kreativ- und Abenteuer-Modus – mehr auf Angriff und Verteidigung setzt. Spieler benötigten Erfahrung, Planung, Fantasie und Kreativität. Experten raten: Kinder sollten beim recht grenzenlosen Spielverlauf nicht die Zeit aus dem Blick verlieren. Jüngere sollten anfangs mit Erfahrenen daddeln.

Ein Junge spielt das Open-World-Computerspiel Minecraft. Foto: picture alliance/dpa | Georg Wendt
„Fifa/EA Sports FC“ (USK ab 12 Jahren)
Jedes Jahr ein neuer Teil: Nicht nur hierzulande gehört die Fußball-Simulationsreihe seit den 90er-Jahren stets zu den meistverkauften Games des Jahres. Spieler steuern ihre originalgetreu animierten Fußballstars auf dem Feld und managen ganze Vereine. Bisher klebte auf allen „Fifa“-Teilen das Logo „ab 0 Jahren“. Der diesjährige Nachfolger – aus Lizenzgründen „EA Sports FC“ genannt – wird von der USK aber erst „ab 12 Jahren“ freigegeben.
Grund sind keine Blutgrätschen, sondern der beliebte Spielmodus „Ultimate Team“ (FUT). Darin können Spieler für mehr Erfolge bestimmte Inhalte mit einer im Spiel verdienten Kunstwährung kaufen – oder als Abkürzung echtes Geld ausgeben. Seit Jahresbeginn bewerten die Jugendschützer der USK Möglichkeiten für solche In-Game-Käufe strenger. So sollen Eltern, Kinder und Jugendliche besser vor Kostenfallen geschützt werden. Eltern sollten darauf achten, ob und wie viel Taschengeld ihres Kindes in die Spielwährung fließt.
„Fortnite: Battle Royale“ (USK ab 12 Jahren)
Ziel in dem kostenlosen Online-Spiel ist es, von 100 Spielern auf einer verlassenen Insel als letzter Charakter am Leben zu bleiben. Antreten kann man in verschiedenen Spielmodi allein, zu zweit oder in Viererteams. Per Sprachchat kann man sich im Team austauschen und Strategien besprechen.
Für das Überleben müssen Spieler Rohstoffe und Ausrüstung sammeln. Neben Gefechten sind auch das Suchen, Verstecken und Bauen wichtig für den Erfolg. Die entschärfte Grafik lässt das Spiel zwar oft kindlich wirken. Und doch laufen „Fortnite“-Partien immer auf das Abschießen von Gegnern hinaus. Blut oder Leichen werden aber nicht gezeigt. Ein weiteres Risiko laut Experten: Spieler können mit einer virtuellen Währung die eigene Spielfigur optisch aufwerten, was durchs reine Spielen deutlich länger dauert. Unterm Strich ist das bei Kindern und Jugendlichen beliebte „Fortnite“ vor allem für Jüngere nicht geeignet. Manche Experten raten dazu, das Spiel erst mit 14 Jahren zu erlauben.
Auf der Rangliste der Jugendstudie JIM rangieren mit dem Gangster-Epos „GTA – Grand Theft Auto“ und dem Weltkriegs-Shooter „Call of Duty“ (beide USK 18) zwei weitere Spieleserien. In beiden spielen Waffen und Gewalt für den Erfolg eine große Rolle, beide werden von Jugendschützern kritisch beäugt.

Ein Kind spielt ein Spiel auf einem Mobiltelefon mit einem Bild des Fortnite-Spiels auf dem Computerbildschirm im Hintergrund. Foto: picture alliance/dpa/ZUMA Wire | Herwin Bahar
Interesse zeigen
Wie gehen Eltern mit der Gaming-Leidenschaft ihrer Kinder vernünftig um? „Um Jugendliche bei einer verantwortungsvollen und selbstbestimmten Mediennutzung zu unterstützen, sollten Eltern zunächst Interesse für die Begeisterung ihres Kindes zeigen“, sagt Stephanie Eckhardt, Referentin für Suchtprävention der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Regelmäßige Gespräche böten die Möglichkeit, sich offen auszutauschen, auch über mögliche Sorgen und Herausforderungen. Eltern sollten einen verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien vorleben, so Eckhardt.
Wichtig sind der Expertin zufolge etwa Regeln, die gemeinsam aufgestellt werden und für alle Familienmitglieder gelten. Aber auch gemeinsame Familienzeit „offline“, mit Aktivitäten und Unternehmungen ganz ohne Handyspiele und Internet. Von Maik Henschke, Funke Medien Gruppe