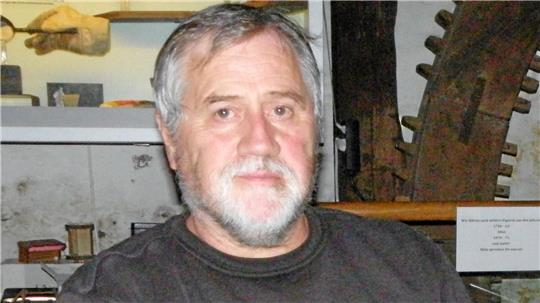Natur zwischen „Saurem Regen“ und „Waldsterben“

Tote Fichten stehen dicht an dicht am Straßenrand der Bundesstraße 4 zwischen Königskrug und Torfhaus. Fotos: Seltmann
Harz. In der Kernzone des Nationalparks entsteht ein neues Gesicht des Waldes. Sabine Bauling von der Nationalparkverwaltung spricht über Entwicklungen vor dem Hintergrund der Umwelteinflüsse.
Für nur 0,99 € alle Artikel auf goslarsche.de lesen
und im ersten Monat 9,00 € sparen!
Jetzt sichern!
Skelette dürrer Fichten ragen in den blauen, wolkenlosen Himmel. Zwischen Königskrug und Torfhaus flankieren sie die Bundesstraße. Weit ins Hinterland erstrecken sich die toten Wälder. Mit Sabine Bauling, Fachbereichsleiterin Waldentwicklung und Wildbestandsregulierung im Nationalpark Harz, sprach GZ-Redakteurin Ina Seltmann über das Schlagwort der siebziger Jahre, „Saurer Regen“ und das vor 40 Jahren proklamierte „Waldsterben“.
Gibt es den Sauren Regen noch, ist das Waldsterben noch ein Thema im Harz?
Diese Begriffe haben die Menschen in den siebziger Jahren erst mal sensibilisiert. Das prognostizierte Waldsterben war sicherlich übertrieben. Aber es war wichtig und richtig, dass die Menschen aufgerüttelt wurden und sich Gedanken über die Folgen ihres Handelns auf die Umwelt machten.
Der Saure Regen schwingt bis heute nach und hat im Waldboden seine Spuren hinterlassen, denn der Boden vergisst nicht. Die Auswirkungen des Schwefeldioxids aus den Verbrennungsprozessen fossiler Brennstoffe wie Kohle, Erdöl, Erdgas ist bis heute in den Böden nachweisbar. Einen Teil kann der Boden abpuffern, das „Zuviel“ allerdings führt zur starken Absenkung des pH- Wertes, was unter anderem dazu führt, dass Aluminiumionen, ein Pflanzengift, frei werden. Diese zerstören die Feinwurzeln der Bäume und somit die Wasser- und Nährstoffversorgung.
Insbesondere sind die höheren Lagen der Gebirge betroffen, weil es hier mehr Niederschläge und auch Nebel gibt. In den Achtzigern wurden dann Filtersysteme zur Rauchgasentschwefelung eingesetzt und auch Maßnahmen entwickelt, um die Treibstoffe von Verbrennungsmotoren zu entschwefeln. Hier hat es in den vergangenen Jahrzehnten große Fortschritte gegeben, vor allem auch in der internationalen Zusammenarbeit.
Die Forschung auf diesem Gebiet hat sich ständig weiter entwickelt. Dabei wird immer wieder deutlich, dass es sich hierbei um stark vernetzte Prozesse handelt, die nicht auf eine Einzelursache wie zum Beispiel Saurem Regen zurückzuführen ist. Die auftretenden Schäden an den Bäumen sind sehr vielfältig. Ein weiteres Problem sind zum Beispiel die Einträge von Stickoxiden, die bei Verbrennungsprozessen mit hohen Temperateuren in Kraftfahrzeugen und auch Kraftwerken entstehen, dafür gibt es heute noch keine umfassenden Lösungen.
Spielt das Stichwort Klimaveränderung eine Rolle?
Das ist ein sehr wichtiges Stichwort. Dieser Sommer etwa zeigte deutliche Witterungsveränderungen, er war zwei Grad zu warm. Allerdings werden diese Phänomene schon seit mehreren Jahren beobachtet. Neben dem Anstieg der Durchschnittstemperatur ist auffällig, dass sich das Niederschlagsgeschehen für den Wald dramatisch verändert. Die Verteilung der Niederschläge über das Jahr weichen in den einzelnen Monaten oft vom langjährigem Mittel ab, sowohl nach unten („Frühjahrstrockenheit“) aber auch nach oben (Starkregenfälle). Es gibt eine Verlängerung der Zeit des Pflanzenwachstums. Lange Hitze- und Trockenperioden bringen den Fichten Stress, das macht sie anfälliger für Schadfaktoren wie Insekten oder Pilzen. Im Nationalpark zum Beispiel immer wieder ein heiß diskutiertes Thema: der Achtzähnige Fichtenborkenkäfer, auch „Buchdrucker“, aber auch Pilze wie der Hallimasch nehmen zu.
Das Problem langlebiger Lebewesen, wie Bäume es sind, ist, dass sie den sich verändernden Umweltbedingungen nicht ausweichen können.
Die Kombination der genannten Faktoren, dabei sind längst nicht alle genannt, haben gravierende Auswirkungen auf den Wald.
Diese sind nicht nur negativ, denn die Bäume können auch bessere Zuwächse bringen, gut zu sehen an jungen Fichten der Hochlagen, die bis zu 40 Zentimeter im Jahr höher werden.
Wie sehen Sie die Rolle des Borkenkäfers im Nationalpark?
Der Nationalpark Harz hat gegenwärtig eine Naturdynamikzone von 60 Prozent, das ist der Bereich, in dem der Mensch nicht mehr eingreift. Hier gilt das Prinzip „Natur Natur sein lassen“. Das gilt bis auf wenige Ausnahmen wie an öffentlichen Straßen oder im Sicherungsstreifen an der Grenze zu Nachbarforstbetrieben. Damit werden Entwicklungen angestoßen, die für den Harz neu sind. Es findet eine Waldumwandlung in historischer Dimension statt. Aus strukturarmen Fichtenforsten entsteht ein naturnäherer Bergfichtenwald mit Anteilen von Laubhölzern, ungleich alten Bäumen, Licht- und Schattenbereichen. Der Borkenkäfer kann sich ungehindert entwickeln. Er findet in den Fichtenforsten einen überaus reich gedeckten Tisch an dicken Fichten, die genau sein Nahrungs- und Fortpflanzungsoptimum sind. Die Dynamik dieser Prozesse ist rasant und nicht immer leicht zu verstehen.
Es ist beeindruckend, wie rasch in den Bereichen der abgestorbenen Fichten neues Leben aus dem Waldboden entsteht, Kräuter, Ebereschen, Weiden, kleine Fichten. Es bleibt spannend zu beobachten, wie die Entwicklungen der Natur vor dem Hintergrund der Umwelteinflüsse vonstatten gehen werden. Dies wird in einem Gebiet wie dem Nationalpark Harz intensiv beobachtet. Gerade läuft die Waldinventur, die den Istzustand der Waldstrukturen erfasst und in zehnjährigem Turnus wiederholt wird.