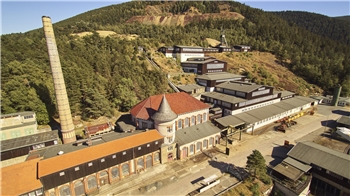Die alten Eliten sind schnell wieder da

Markantes Ereignis der Nachkriegsgeschichte: Ende März 1948 brennt die Stadthalle. Foto: Stadtarchiv/Repro: Schenk
Was legt Historiker Dr. Peter Schyga mit seiner Arbeit zu den acht unmittelbaren Nachkriegsjahren seinen Auftraggebern bei der Stadt Goslar in der kommenden Woche (siehe Hintergrund) auf den Tisch ? „Die Studie stützt sich auf umfangreiches Aktenmaterial zur politischen Entwicklung, ersetzt das Geschichtenerzählen aus dieser Zeit und erzählt ihrerseits, was tatsächlich abgelaufen ist“, kündigt der Autor selbstbewusst an. Was hat ihn am meisten erstaunt? „Die ideologische Nähe zur Endzeit von Weimar und die Integration von alten NS-Funktionseliten hätte ich in dieser Krassheit nicht erwartet.“
Soll heißen: Kommunisten und Sozialdemokraten, die das Regime der Nazis – bestraft und gedemütigt – überlebt hatten, arrangierten sich nach dem Krieg „sofort wieder mit ihren Peinigern – als ob es vorher keine Feinde gegeben hätte, die sie geknechtet hatten“. Die SPD habe mehr an der deutschen Niederlage im Krieg gelitten als an ihrem eigenen Schicksal – und nicht gezögert, sich mit ihren Häschern wieder an einen Tisch zu setzen.
Es ging in diesen Jahren erstaunlich friedlich zu in einer Stadt, in der bis 1948 neben vielen deutschen Flüchtlingen auch noch viele Freigelassene unterwegs waren. Ukrainer und Polen, die nicht mehr in ihre alte Heimat zurückwollten – „es gab keine Schlägereien, keine politischen Angriffe, nirgends wurde geplündert.“
Aber demokratischer Aufbruch? Mitnichten, meint Schyga. Von der SPD unterstützt, setzten sich sofort wieder die alten Eliten an die Spitzen. Den einst von den Nazis vertriebenen Stadtsyndikus Dr. Rudolf Wandschneider, nach dem Krieg zunächst als Oberbürgermeister eingesetzt, wurde laut Schyga 1948 von seinem CDU-Nach-Nachfolger Conrad Bruns „ziemlich heftig aus seinem Amt in der Verwaltung gejagt“. Der frühere SPD-Bürgervorsteher Wilhelm Schacht wurde 1947 als Leiter des Sozialamtes „geschasst“.
Als ein entscheidendes Datum sieht Schyga die Kommunalwahl vom November 1952 an. CDU, FDP, DP (Deutsche Partei) und Unabhängige kandidierten zusammengefasst auf einer Einheitsliste. Für die Liberalen zogen der frühere NS-Oberbürgermeister Heinrich Droste und Bürgermeister Hermann Mühlenberg in den Rat ein. Nach dem Ende ihrer Internierung seien sie sofort wieder in die Politik eingestiegen, so Schyga. Phänomen Droste: Dem Goslarer Ober-Nazi von einst verweigerten Rat und Hauptausschuss 1950 zunächst die Zahlung seiner Pension –gegen geltendes Bundes- und Landesrecht. Ein Staatskommissar aus dem Innenministerium musste nach Goslar kommen. Zwei Jahre später stand Droste mit einigen dieser Politiker auf einem Wahlzettel – und gehörte zu jener Handvoll Bewerbern, denen die Goslarer die meisten Stimmen gaben.
Wie funktioniert so etwas? „Die Verweigerung der Pension hat die Goslarer Politik wohl als kollektives Entnazifizierungssignal gewertet und sich anschließend mit ihrer angeblich weißen Weste ganz wohlgefühlt“, sagt Schyga – frei nach dem Motto: Der Versuch war da, die Obrigkeit hat es verboten.
Aber wie war ein Mann nach dem Krieg wieder wählbar, der alle zwölf Nazi-Jahre lang an der Spitze der (Reichsbauern-)Stadt gestanden hatte? Laut Schyga: Indem er Legenden strickte. Droste fügte seine Legende zu den vielen Legenden um die Rettung der Stadt beim Einmarsch der US-Truppen im April 1945 hinzu. Er sei gar nicht abgehauen, sondern habe an der Übergabe der Stadt aktiv mitgewirkt. In Wahrheit sei er schon immer ein Demokrat gewesen. Und als Verwaltungschef habe er etwa die Vorgänge in der Pogromnacht im November 1938 verurteilt und niemals erlaubt. „Fake News hatten auch damals schon ihre Wirkung“, sagt Schyga lakonisch.
Welches Fazit zieht der Historiker? Er vergleicht die politische Situation mit der früheren Lage am Goslarer Bahnhof, wo die Schranken regelmäßig Chaos verursachten, bis sie schließlich durch eine Unterführung ersetzt wurden. „Das politische Leben hatte sich gestaut“, erklärt er. Die Verkehrsstaus wegen der Bahnschranken am Rande der Innenstadt sollten die Menschen bis in die neunziger Jahre beschäftigen. „Die Stockungen auf dem Weg eines mentalen und politischen Ankommens in einer demokratischen Republik unter produktiver Bearbeitung eigener Vergangenheit blieben ebenso hartnäckig.“
308 Seiten plus Literaturverzeichnis ist das Manuskript dick, das Dr. Peter Schyga am Montag bei der Stadt Goslar abliefert. Der Vorsitzende der Harzer Spurensuche hat sich mit der Nachkriegsgeschichte der Stadt befasst. „Goslar 1945 bis 1953“ lautet der Arbeitstitel der Studie.
In welcher Form und wie schnell das Buch veröffentlicht wird, steht noch nicht fest. Kultur-Fachdienstleiter Christoph Gutmann müsse zunächst mit dem Geschichtsverein das Gespräch über das weitere Vorgehen suchen, erklärte Sprecherin Elke Dreßler.
Stadt und Verein sind (finanzielle) Partner in einem Projekt, das neben Schygas Part zur unmittelbaren Nachkriegszeit auch eine Goslarer Gesamtgeschichte umfasst. Sie wird unter der Regie des Niedersächsischen Instituts für Historische Regionalforschung Hannover erstellt und soll bis 2022 zum 100. Geburtstag des Geschichtsvereins fertig sein.
Schyga hatte in seinem Buch bereits die Goslarer Geschichte von 1918 bis 1945 („Von der nationalen Stadt zur Reichsbauernstadt des Nationalsozialismus“) beleuchtet. Das Werk war 1999 als Band 46 der Beiträge zur Geschichte der Stadt Goslar/Goslarer Fundus im Bielefelder Verlag für Regionalgeschichte erschienen.