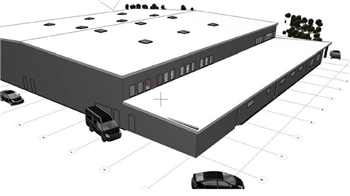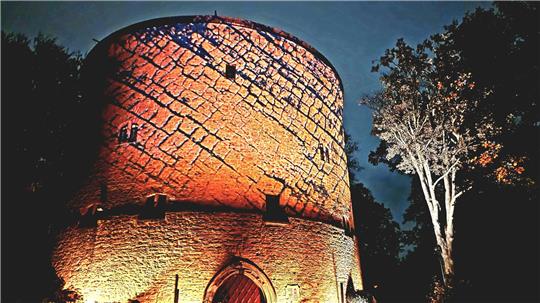10.April 1945: Rascher Wechsel in die Opferrolle

Die US-Amerikaner ziehen am 10. April 1945 in Goslar ein. Das historische Foto, das das Stadtarchiv Goslar zur Verfügung gestellt hat, zeigt Infanteristen der 83. Division der US-Nord-Armee auf ihrem Vorstoß im Schleeke. Die Aufnahme stammt aus dem National Archives Department of Defense, Still Media Depository, in Washington D.C..
Am 10. April 1945 war für die Menschen, die sich in der Stadt Goslar befanden, der Zweite Weltkrieg vorbei, die Macht der lokalen Hitlerdiktatur zerbrochen. Goslar wurde den heranrückenden amerikanischen Truppen übergeben. Bad Harzburg fiel den Amerikanern kampflos in die Hände. In Wernigerode verweigerte Kampfkommandant Oberst Gustav Petri die befohlene Verteidigung der Stadt, was er mit seinem Leben bezahlte. Die Schergen des NS-Regimes ermordeten ihn. Die Stadt blieb erhalten.
Für nur 0,99 € alle Artikel auf goslarsche.de lesen
und im ersten Monat 9,00 € sparen!
Jetzt sichern!
Die Kämpfe im Harz waren noch nicht vorbei. Von Altenau Richtung Torfhaus vorrückende US-amerikanische Truppen trafen am 14. April auf heftigen Widerstand durch SS-Truppen und Volkssturm. Einen Tag später wurde die Siedlung besetzt. Der Ort stand noch einige Zeit unter Beschuss deutscher Artillerie. Auch kam es immer wieder zu kleinen Gefechten und Hinterhalten durch versprengte deutsche Soldaten, die sich in den Wäldern versteckt hielten.
Am 17. April wurde der Brocken von US-Luftstreitkräften bombardiert. Am 19. April begann die US-Armee von Schierke aus über die Brockenstraße den Angriff auf den Brocken, der von circa 150 Mann verteidigt wurde. Am 22. April ergaben sich die letzten Truppenteile des Harzes in Blankenburg.
Seit dem Überfall der deutschen Truppen auf Polen am 1. September 1939 hatten sich die Deutschen – auch die Stadt Goslar und ihre Einwohner – im Kriegsmodus befunden. Zu Beginn – ob der Erfahrungen des Ersten Weltkriegs noch zurückhaltend – euphorisierte der Siegeszug der Wehrmacht durch Europa die Menschen. Ihre Ergebenheit dem „Führer“ und seinen örtlichen Statthaltern gegenüber, die sie in ihrer übergroßen Mehrheit im März 1933 gewählt und danach immer wieder in Treuebekundungen bestätigt hatten, wich nun der Angst – vor den heranrückenden Feindtruppen und den Häschern des NS-Regimes.
Die von der NS-Gauleitung unter Hartmann Lauterbacher verbreiteten Durchhalteparolen – wie „Heimatliebe macht stark“, „Unser Osterglaube: Das Reich“, „Nur der Kampf kann den Sieg bringen“ – konnten zwar kaum noch verfangen. Doch diese markigen Sprüche waren von den Dienststellen des Gaus, der SS und der NS-Kreisleitung mit Drohungen gegen so bezeichnete Defätisten, Gerüchteverbreiter, Feiglinge oder Hundsfotts verbunden.
Dass diese Warnungen todernst gemeint waren, konnte jeder seit Wochen der Zeitung und dem Rundfunk entnehmen, in denen sich Meldungen vom „rücksichtslosen Vorgehen“ gegen „Feiglinge“, Deserteure und Plünderer häuften. „Kettenhunde“ und Standgerichte, sich selbst ermächtigende oder von der NSDAP eingerichtete Mordkommandos streunten lynchend durch die Gegend. Im Untergehen noch möglichst viele von den eigenen Leuten mitreißen, lautete deren Parole.
Unmittelbar nach Ostern brach noch am 7.April eine Abteilung Volksturm in Richtung Brocken auf. NSDAP-Kreisleiter Friedrich Pfeiffer sowie Parteigenosse, SS-Sturmführer und Oberbürgermeister Heinrich Droste aus Goslar ließen am Morgen dieses Tages ein Flugblatt verteilen, in dem es unter anderem hieß: „Nur der Kampf kann den Sieg bringen. Volksgenossen und Volksgenossinnen! … Kein Schritt auf unserem heiligen Heimatboden soll ihm (also dem Feind; der Autor) kampflos möglich sein.“ Der Kreisleiter ward anschließend nicht mehr gesehen.
Am frühen Abend des 7. April, nach einer Besprechung zwischen den Resten der NS-Kreisleitung, der Stadtführung und den militärisch Verantwortlichen, ließ die Partei durch Lautsprech-Durchsagen ihr Flugblatt dementieren und schloss sich dem Übergabe-Begehren Goslarer Bürger an. Stadtsyndikus Rudolf Böttcher und Kämmerer Heinrich Wulfert sicherten dem Kommandanten der amerikanischen Vorausabteilung auf dem Bahnhofsvorplatz die sofortige Einstellung von Schießereien aus dem Steinberg- und Nordberggebiet und die kampflose Übergabe zu.
Die Amerikaner hatten von den Goslarer Unterhändlern verlangt, die Stadt müsse zum Beweis der Friedfertigkeit ihrer Bürger weiß beflaggt werden. Die Beflaggung lief nicht reibungslos ab. Einer der Zeitzeugen und Chronisten von damals, Unternehmer Dr. Otto Fricke, berichtet von „sehr unerfreulichen Streitigkeiten mit nationalsozialistischen Elementen in den verschiedensten Stadtteilen.“ Menschen, die sich demonstrativ ergeben wollten, seien bedroht und beschimpft worden.
Doch soweit man beurteilen kann, lief die Übergabe von Goslar glimpflich ab. Häuser wurden nach Waffen und möglichen Schwarzmarktgütern durchsucht, Quartier für die Truppe beschlagnahmt, die wichtigsten Verkehrsknotenpunkte und Verwaltungsgebäude besetzt. Mancher, der nicht schnell genug aus seiner Parteiuniform herauskam, wurde verhaftet. Eine systematische und gezielte Verfolgung von lokalen NS-Größen lief erst später unter britischem Kommando an.
Im Ort war erst einmal Ruhe, gewiss noch eine gespannte. Es herrschte eine von Unsicherheit und Ungewissheit erfüllte Atmosphäre. Ein kollektives Aufatmen schien fast hörbar, dass die Amerikaner statt der „Russen“, wie die Soldaten der sowjetischen Armee genannt wurden, die Stadt besetzt hielten. Ergriff die Stadtbewohner nun darüber hinaus eine tiefe Erleichterung, vom NS-Regime befreit zu sein? Die deutschen Volksgenossinnen und Volksgenossen waren in ihrer Mehrheit erleichtert, dass der Krieg vorüber war, doch als Befreite fühlten sich die wenigsten, vielmehr als Geschlagene. Sie streiften die Opferrolle über.
Viele hatten als Herren über Leben und Tod gehandelt, haben sich aufgeschwungen, Ansprüche als Herren der Welt, als Herren über Sklaven und Heloten geltend zu machen und zu verwirklichen. Ihr Trauma bestand im Frühjahr 1945 darin, dass trotz millionenfachen Mordens und des Plünderns eines Kontinents aus dem Herrendasein nichts geworden war, dass sie zu schlichten Befehlsempfängern der Alliierten degradiert waren, sogar noch ausführlich Rechenschaft ablegen mussten über ihr Treiben seit 1933.
Nun fühlten sich die Anhänger und Fans Adolf Hitlers als Opfer: Opfer der diffusen politischen und sozialen Weimarer Verhältnisse, Opfer von Hitlers Versprechungen auf ein gutes Leben als Machtmenschen in Europa, Opfer des Krieges, Opfer der Niederlage, Opfer der Alliierten – und als Opfer der ehemaligen Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen. Und es mag unverständlich und kaum begreifbar sein: Etliche von Hitlers Opfern, insbesondere SPD-Parteigänger, streiften diese Rolle ebenfalls über.
Auf der ersten Sitzung eines Magistrats, den die ab Juni zuständige britische Besatzungsmacht eingesetzt hatte, war am 29. Juni 1945 von einem „Hurra, wir leben noch!“ oder von einer kollektiven Erleichterung, Hitlers Diktatur beendet zu sehen, nichts zu spüren. Der ehemalige Senator Wilhelm Söffge, SPD-Mitglied und von den Nationalsozialisten übel drangsalierter Handwerksmeister, eröffnete die erste Sitzung mit den Worten:
„Es ist ein trauriges Erbe, das wir antreten. Wir werden alles daransetzen müssen, um die Schwierigkeiten zu meistern. Wir beide – Senator (Gustav) Schwickard und ich - haben uns als geborene Goslarer und aus Liebe zu Wald und Feld entschlossen, dieses Amt wieder anzunehmen.“
Das Gremium bildeten: als Oberbürgermeister der langjährige sozialdemokratische Syndikus und 1933 aus der Stadt gejagte Dr.Rudolf Wandschneider; als Senatoren der langjährige SPD-Senator Söffge, den der Mob am 5. Mai 1933 zusammen mit dem jüdischen Kaufmann Selmar Hochberg im Fleischerkarren durch die Stadt gezogen hatte, und der ehedem republikanische Kaufmann Schwickard; als Stadträte der langjährige SPD-Fraktionschef Wilhelm Schacht, der neu hinzubestimmte KPD-Mann Heinz Elles und Unternehmer Fricke, ehemals DNVP-Mitglied, sowie die auch in der Verwaltung der NS-Zeit tätigen und als unbelastet geltenden Stadtkämmerer Heinrich Wulfert, Stadtbaudirektor Karl Schneider und Stadtforstmeister Alexander Grundner-Culemann.
Hinzu kam der frisch aus Auschwitz-Monowitz herbeigeeilte IG-Farben-Abteilungsleiter Helmut Schneider, der als Assessor im städtischen Führungsgremium Platz fand. Protokollführer war Stadtinspektor Hans-Günther Griep. Diese versammelten städtischen Honoratioren hoben einmütig die Klage über die miserablen sozialen Verhältnisse in der Stadt an: Die Nahrungsrationen wären zu gering, es fehlte an Wohnungen, es gäbe keine Transportmöglichkeiten, der Stadtforst würde geplündert, und sowieso würden die „Ausländer“ – damit waren die 2000 befreiten Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter gemeint, die noch nicht in ihre Heimatländer zurückgekehrt waren – sich ungebührlich benehmen, würden faulenzen und plündern und deutsche Frauen belästigen. Und ihr Unterhalt belaste den städtischen Haushalt über Gebühr.
Ganz so, als ob die Welt am 9.April noch in Ordnung gewesen wäre, als ob ein Unglück am 10.April 1945 über die Stadt gekommen wäre. Gewiss: Der Ort war mit Menschen überfüllt. Neben den etwa 27.000 Einwohnern befanden sich nach Schätzungen 8.000 bis 10.000 evakuierte Menschen aus ausgebombten Städten und Flüchtlinge aus dem Osten sowie mehr als 3.000 zum Großteil schwer verletzte Soldaten in den Lazaretten der Stadt. Alle brauchten Nahrung, Wasser, Strom, Kleidung – und von allem gab es zu wenig.
Doch Mangelbewirtschaftung kannte die reichsdeutsche Bevölkerung spätestens seit Ende 1943. Öffentlich verkündete Tipps zur Sparsamkeit lauteten: „Die Thermoskanne spart Heizmaterial; Kartoffeln bei starkem Frost zudecken; prüfen Sie den Stromverbrauch; wir holen uns Holz aus dem Wald“.
Im Frühjahr 1945 spitzte sich die Versorgungslage zu. Das „Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft“ ordnete an: „Die Haltung von Gänsen, Enten, Truthühnern und Perlhühnern ist ab dem 1. April 1945 verboten.“ Die verfütterte Menge von 1,5 Millionen Tonnen Getreide und ebenso viel Kartoffeln gehe der Versorgung des deutschen Volkes verloren, hieß es.
Im Harzer Tageblatt vom 28.März wurde ein „neues Kartensystem“ für die 74. Zuteilungsperiode vom 9. bis 29. April bekannt gegeben, das keine fixen Zuteilungsmengen mehr formulierte, sondern die lokale Verwaltung des erheblichen Mangels anordnete. Decodiert hieß dies: „Seht zu, wie ihr klarkommt.“
Die zeitgenössische Wahrnehmung vieler, dass nichts besser geworden sei, dass man nun unter fremdem Kommando, unter dem des Feindes, darben müsse, als Deutscher, als Besiegter nichts mehr zu sagen hätte, prägte die deutsche Nachkriegsgesellschaft nachhaltig. Von Befreiung sprach jedenfalls kaum ein Volksgenosse, kaum eine Volksgenossin.
Von Dr. Peter Schyga
Über den Autoren
Der Hannoveraner Historiker Dr. Peter Schyga ist nicht nur langjähriger Vorsitzender der Spurensuche Harz-region, sondern auch ein profunder Kenner der Goslarer Geschichte im 20. Jahrhundert.
Zuletzt kam im Dezember 2017 als Band 58 der „Beiträge zur Geschichte der Stadt Goslar/Goslarer Fundus“ sein Buch zur Nachkriegsgeschichte im Bielefelder Verlag für Regionalgeschichte heraus. Der Titel lautet: „Goslar 1945 bis 1953. Hoffnung – Realitäten – Beharrung“. Er kostet 14,90 Euro. Herausgeber sind Geschichtsverein und Stadt Goslar.
Bereits 1999 ist Schygas Werk „Goslar 1918 bis 1945“ als Band 46 der Reihe erschienen. Der Untertitel lautet „Von der nationalen Stadt zur Reichsbauernstadt des Nationalsozialismus“.
Dazwischen hatte sich Schyga unter anderem 2009 in einem von Propst Helmut Liersch publizierten Buch mit den Goslarer ev.-luth. Gemeinden in der NS-Volksgemeinschaft beschäftigt: zwischen Selbstbehauptung, Anpassung und Selbstaufgabe in der Reichsbauernstadt des Nationalsozialismus.