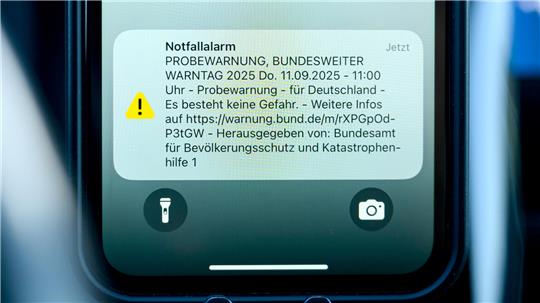Energiepark: Wie Bad Harzburg Deutschlands Vorreiter werden könnte
Energiepark: Wie Bad Harzburg Deutschlands Vorreiter werden könnte

Die Unterstützung für den Energiepark bei Harlingerode ist groß, die Voraussetzungen sind nahezu erfüllt. Mit dem Bau von Photovoltaikanlagen soll noch in diesem Jahr begonnen werden. Foto: (Collage) GZ-Archiv
Harlingeröder Eigentümer sowie die Firmen Landwind und Fest planen nahe Bad Harzburgs Ortsteil Harlingerode einen Energiepark, in dem grüner Wasserstoff produziert werden soll. Wer davon profitieren soll und warum in Sachen Umsetzung die Zeit drängt.
Harlingerode/Oker. Man stelle sich vor, es gebe einen Park aus Windrädern und Photovoltaik-Modulen, die so viel Strom produzieren, dass nicht nur Hunderte Haushalte damit versorgt werden können, sondern mit der Energie auch grüner Wasserstoff hergestellt wird, den Unternehmen im Umkreis für ihre Produktion oder als Treibstoff nutzen können. Die bei dem Prozess ebenfalls entstehende Wärme kann wiederum zum Heizen verwendet werden. Weht der Wind mal besonders stark oder ist der Himmel wolkenlos, dann fließt der erzeugte Strom zusätzlich in eine große Batterie – für die Zeiträume, in denen mal weniger erzeugt werden kann.
Das klingt doch eigentlich nach einer sinnvollen und nützlichen Idee, oder? So sehen das jedenfalls eine Gruppe Harlingeröder Landeigentümer sowie die Firmen Fest und Landwind. Sie haben bereits vor längerer Zeit verkündet, genau einen solchen Energiepark auf dem Kalten Feld nördlich der Bundesstraße 6 bei Bad Harzburg bauen zu wollen. Wobei die Beteiligten mittlerweile von einem „Synergiepark“ sprechen, denn auch die TU Clausthal begegnet der Idee offen und interessiert und selbst die Umweltverbände BUND und Nabu haben nach eigenen Angaben grundsätzlich nichts gegen das Großprojekt einzuwenden – eher eine Seltenheit. Das seien „einmalige Voraussetzungen“. Sogar politisch gibt es mittlerweile grünes Licht, den Energiepark Wirklichkeit werden zu lassen. Dafür muss nämlich der entsprechende Flächennutzungsplan geändert werden. Dafür sprach sich der Bad Harzburger Stadtrat bereits im April 2024 mehrheitlich aus, doch die Stadtverwaltung hat diesen „Auftrag“ bislang noch nicht umgesetzt.
Deutschland hinkt hinterher
Während eines Treffens bei der Firma H.C. Starck Tungsten in Oker, zu dem zwar auch Bad Harzburger Ratsmitglieder, aber niemand von der Stadtverwaltung eingeladen worden war, haben die Energiepark-Initiatoren jetzt noch einmal intensiv für das Projekt geworben, um nicht zu sagen Druck gemacht. Begründung: Insbesondere für Unternehmen, die für ihre Produktion besonders viel Strom benötigen – H.C. Starck nahmen sie als Beispiel – bräuchten dringend niedrigere Energiekosten, um künftig noch wettbewerbsfähig zu bleiben.
Aktuell ist es so: Wenn in Deutschland mehr Strom durch Windräder und PV produziert wird, als das Stromnetz aufnehmen kann, dann werden die Anlagen abgeschaltet. Dafür zahlt der Staat den Betreibern eine Entschädigungsgebühr. Allein im vergangenen Jahr waren das gut 554 Millionen Euro. Dazu müsste es nicht kommen, gebe es bessere Netze oder mehr Speicher- oder Nutzungsmöglichkeiten, wie es beim Energiepark der Fall sein soll.
Auch bräuchte es den grünen Wasserstoff, damit die von der Bundesregierung gesteckten Klimaziele erreicht werden könnten, so die Initiatoren. Aktuell wird der in Deutschland für die Produktion verwendete Wasserstoff nämlich in der Regel mithilfe von Erdgas erzeugt. Die Produktionskosten beziehungsweise der Preis sind hoch. Andere Länder sind da schon weiter, in Deutschland steckt die Produktion grünen Wasserstoffs in großem Stil noch in den Kinderschuhen. Der Energiepark in Bad Harzburg wäre in seiner Form eine Neuheit, ein „Leuchtturmprojekt“. Der Kurstadt käme dank ihm eine Vorreiterrolle zu, schwärmen die Initiatoren. Und auch die Städte Bad Harzburg und Goslar würden von dem Energiepark profitieren, so die Begründung, nämlich durch die Gewerbesteuer und eine sogenannte Akzeptanzabgabe. An Letzterer scheiden sich allerdings die Geister (Bericht folgt).
Lieferung per Direktleitung
Und profitieren würden eben auch Teile der lokalen Wirtschaft, versprechen die Engergiepark-Initiatoren. Exemplarisch H.C. Starck Tungsten, Angaben der Initiatoren zufolge zweitgrößter Abnehmer von Wasserstoff in der Region nach der Firma Salzgitter-Flachstahl.
Das Okeraner Unternehmen ist nach Auskunft von Standortleiterin Juliane Saupe weltweit führender Produzent von Wolframpulver mit Fokus auf Recycling. Es handle sich um ein sehr energieintensives Gewerbe: Pro Jahr benötige das Unternehmen bei Normalbetrieb 50 Millionen Kilowattstunden Strom sowie 75 Millionen Kilowattstunden Gas. Angenommen, die Produktion werde in Zukunft weiter automatisiert und die Firma expandiert womöglich weiter, dann würde der Energiebedarf sich mindestens verdoppeln, schätzt Saupe.
Aktuell seien die Strompreise in Deutschland doppelt so hoch wie vor dem Ukraine-Krieg. In China wiederum, wo H.C. Starck Tungsten ebenfalls einen Standort betreibt, zahlt das Unternehmen derzeit gerade mal ein Fünftel des hiesigen Energiepreises. Auch an den weiteren Standorten in Kanada und Japan zahle man weniger.
Neben einer Reduzierung des Strompreises erhofft sich das Unternehmen vom Energiepark aber auch eine Versorgung mit grünem Wasserstoff. Sie könnte laut Initiatoren theoretisch sogar per Direktleitung von Harlingerode nach Oker erfolgen. H.C. Starck hat laut Saupe einen Wasserstoff-Bedarf von jährlich drei Millionen Kubikmetern.
PV-Module bereits genehmigt
Und wie würde der Energiepark nach jetzigem Planungsstand aussehen? Dürften die Initiatoren loslegen und es gebe eine entsprechende Baugenehmigung, würden auf den Feldern nördlich von Harlingerode, auf einer Fläche von 130 Hektar, acht Windräder mit einer Höhe von circa 270 Metern errichtet werden. Sie hätten eine Nennleistung von 56 Megawatt und würden pro Jahr etwa 140 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen. Theoretisch würde das reichen, um den Jahresbedarf von mindestens 35.000 Haushalten zu decken. Die betroffenen Flächen können nach Angaben ihrer Besitzer nicht für den Nahrungsmittelanbau genutzt werden. Aufgrund der Belastung durch Cadmium und Blei dürfen dort lediglich Futterpflanzen für Tiere geerntet werden.
Auf weiteren 25 Hektar Fläche entstehen zudem rund 50.000 PV-Module mit einer installierten Nennleistung von 30 Megawatt. Sie sollen 30 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr produzieren. Für sie läge bereits eine Genehmigung vor, sagt Alexander Heidebroek, geschäftsführender Gesellschafter der Firma Landwind. Noch in diesem Jahr soll mit dem Bau begonnen werden. Ursprünglich waren diese Module ebenfalls für das Kalte Feld geplant, nun entstehen sie jedoch direkt neben der Autobahn 369, kurz vor der Anschlussstelle Vienenburg.
Anlage wäre erweiterbar
Dazu kämen mehrere Container der Firma Fest, in denen mittels Elektrolyse der Wasserstoff erzeugt wird. Sie könnten wie bei einem Legosystem später noch erweitert werden. Fürs Erste geht Oliver Hennig, Kaufmännischer Leiter der Firma Fest, von einer Produktionsmenge von 1000 Tonnen pro Jahr aus. Der geplante Batteriespeicher mit einer Leistung von 40 Megawatt würde nahe Propsteiburg gebaut werden, eine Wasserstoff-Tankstelle zwischen Immenröder Straße und B6, gegenüber der Papenburg-Betonwerke.
Dank der Wasserstoff-Produktion und der Batterie würde es übrigens auch nicht zu der von manchem befürchteten Netzüberlastung kommen, verspricht Landwind-Chef Heidebroek. Ein geeigneter Netzanschluss sei zudem ebenfalls schon vorhanden.
Die Kosten für den Energiepark, an dem sich laut Initiatoren auch die Bürger beteiligen können sollen, wären im Übrigen gewaltig: Allein die Windräder, die PV-Module und der Batteriespeicher kosten laut Initiatoren rund 135 Millionen Euro. Hinzu kämen die Kosten für die Wasserstoff-Produktionsanlage.
Copyright © 2025 Goslarsche Zeitung | Weiterverwendung und -verbreitung nur mit Genehmigung.