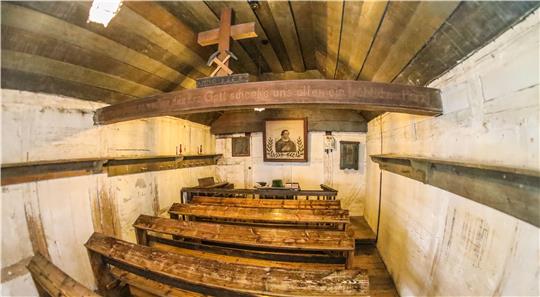Die Bramkebrücke verschwindet: ein Déjà-vu an der Okertalsperre
Die Bramkebrücke verschwindet: ein Déjà-vu an der Okertalsperre

Zu sehen ist nicht etwa der Abriss der Bramkebrücke, sondern ein Rückblick ins Jahr 2012: Nur wenige Meter weiter knabbert ein Bagger an der Weißwasserbrücke. Foto: Archiv/Ebeling
Schritt für Schritt schreitet der Abriss der Bramkebrücke an der Okertalsperre voran, ehe sie neu errichtet werden soll. Vor etwas mehr als zehn Jahren zeigte sich wenige Meter weiter ein ähnliches Bild, das einige Parallelen zu dem Projekt aufweist.
Oberharz. Seit Mitte September läuft an der Bramkebrücke die erste Phase des Abrisses. Bis Mitte Juni soll das Bauwerk vollständig verschwunden sein, ehe dort eine neue Brücke entsteht. So langsam geht es damit Schritt für Schritt voran. Der Anblick erinnert an eine ähnliche Szene, die sich nur wenige Meter weiter vor nicht einmal 15 Jahren abspielte: Auch die Weißwasserbrücke in Richtung Altenau musste damals erneuert werden – ein Projekt, das damals vor allem Altenauern viel Geduld und Umwege im Alltag abverlangte.
Die Brücke war im Zuge des Talsperrenbaus von 1938 bis 1956 in zwei Bauphasen errichtet worden. Doch die Zeit und extreme Witterungsverhältnisse hatten dem Bauwerk zugesetzt. 2005 brachte ein Gutachten Durchfeuchtungsschäden an der Unterseite der fast 300 Meter langen Betonfahrbahn zutage. Die Folge: Zunächst wurde die zulässige Achslast von Lkw auf der Brücke auf zehn Tonnen und die Verkehrsführung auf eine Spur begrenzt. Immerhin zeigte eine weitere Untersuchung im Sommer 2006, dass die bis zu 60 Meter hohen Brückenpfeiler stabil genug waren, um einen neuen Überbau zu tragen. Der Rest der Brücke sollte erneuert werden.
„Komplexe Aufgabe“
„Diese Baumaßnahme ist eine komplexe Aufgabe für alle Beteiligten“, sagte damals der Goslarer Behördenleiter Günter Hartkens. Um unabhängig vom Wasserstand zu bleiben und den Trinkwasserschutz nicht zu gefährden, entschieden sich die Planer für den Bau einer Spannbetonbrücke im Taktschiebeverfahren – ähnlich also wie nun auch bei der Bramkebrücke.
Allerdings ist die Weißwasserbrücke eine wichtige Verbindung, insbesondere für Altenau mit dem nördlichen Harzvorland. Die Sanierung bedeutete also einen harten Einschnitt: Einkäufer, Lieferanten, Berufspendler und Gäste des Ortes mussten monatelang einen Umweg über Clausthal-Zellerfeld in Kauf nehmen. Eine weitere Parallele zur Bramkebrücke. Denn auf ähnliche Weise trifft es aktuell Schulenberger, die aufgrund des Bauvorhabens kilometerweite Umwege fahren müssen, um nach Oker zu gelangen.
Zeitplan gerät ins Wanken
Der ursprüngliche Zeitplan für den Neubau der Weißwasserbrücke geriet ins Wanken. Zunächst war der Baustart für 2009, später für 2010, dann 2011 vorgesehen, mit einer Dauer von 15 Monaten inklusive einer elfmonatigen Vollsperrung. Nun ja, tatsächlich ging es mit der Sperrung im Juni 2012 los, und auch mit der Dauer wollte es nicht so recht klappen. Aber alles der Reihe nach.

Tiefer Einblick in den Taktkeller auf der Altenauer Seite der Weißwasserbrücke: Von hier aus wächst der neue Brückenoberbau nach und nach in Richtung Schulenberger Seite. Foto: Archiv/Bertram
Neun Millionen Euro Kosten
Doch schon in der Vorbereitungsphase zwischen Januar und November 2012 verzögerten aufwendige Zusatzarbeiten wie der Austausch der Lager auf den Pfeilerköpfen den Bau. Dies konnte das hydraulische Schiebeverfahren allerdings überhaupt erst möglich machen. Der überlange, strenge Winter 2012/2013, gab dem ambitionierten Zeitplan den Rest. „Stahl flechten bei minus 15 Grad, das kann man den Arbeitern vor Ort bald nicht zumuten“, sagte damals ein Behördenvertreter. Beton brauche zudem einfach viel mehr Zeit zum Härten, wenn es kalt sei. Und auch der Nachschub stellte sich als problematisch heraus, da das Material in den Lieferfahrzeugen nicht warmgehalten werden konnte.

Stahlbeton auf Eis: Zu knapp einem Drittel ist der neue Überbau der Weißwasserbrücke über die Okertalsperre im Winter fertig. Für den Abbruch der alten Teile stellt der Frost kein Hindernis dar, der Beton-Nachschub für die neuen Brückensegmente ist allerdings problematisch, da das Material in den Lieferfahrzeugen nicht warmgehalten werden kann. Foto: Archiv/Kluge
So verzögerte sich der Bau noch einmal um einige Monate, bis die Sperrung im November 2013 aufgehoben wurde. Den Bund kostete die Sanierung etwa neun Millionen Euro.
Noch kurz vor der Fertigstellung titelte die GZ: „Nächster Kandidat steht schon auf der Warteliste“, nach der Weißwasserbrücke sei auch ihre kleine Schwester, die Bramkebrücke, sanierungsbedürftig. Mehr als ein Jahrzehnt später wiederholt sich nun das Bild des Brückenbaus an der Okertalsperre.
Copyright © 2025 Goslarsche Zeitung | Weiterverwendung und -verbreitung nur mit Genehmigung.