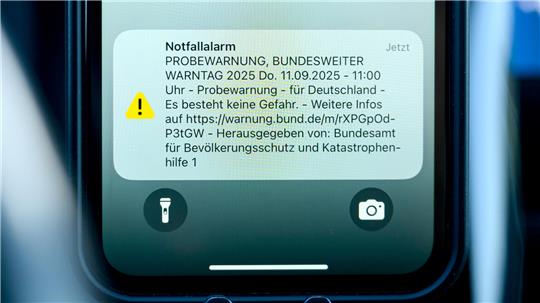Warum der Energiepark Harlingerode trotz Beschluss noch nicht kommt
Warum der Energiepark Harlingerode trotz Beschluss noch nicht kommt

Ende April 2024 referiert Bürgermeister Ralf Abrahms vor dem Stadtrat 20 Minuten lang über den Ausbaustand der Erneuerbaren Energien in Bad Harzburg. Sein Fazit damals wie heute: „Wir haben schon genug.“ Die Ratsmitglieder stimmen anschließend trotzdem mehrheitlich für den Energiepark. Foto: Schlegel/GZ-Archiv
Bereits im April 2024 hat sich der Bad Harzburger Stadtrat mehrheitlich für den Bau des Energieparks bei Harlingerode ausgesprochen. Warum sich dort jedoch bis heute nichts tut und was die sogenannte Akzeptanzabgabe damit zu tun hat.
Harlingerode. Eigentlich ist der Weg für einen Energiepark bei Harlingerode bereits geebnet, den Harlingeröder Landeigentümer gemeinsam mit den Firmen Landwind und Fest errichten wollen: Noch Ende des Jahres soll Baustart für 50.000 PV-Module an der Autobahn 369 bei Vienenburg sein. Und auch die benötigte Änderung des Flächennutzungsplans, damit auf dem Kalten Feld nördlich der Bundesstraße 6 zusätzlich Windräder gebaut werden können und grüner Wasserstoff produziert werden kann, ist bereits beschlossen. Im April vergangenen Jahres hatte sich der Rat bei fünf Gegenstimmen (eine vom Bürgermeister Ralf Abrahms und je zwei von CDU und AfD) sowie zwei Enthaltungen mehrheitlich dafür ausgesprochen. Doch passiert ist bis heute nichts. Warum eigentlich?
Die Argumente, die von den Energiepark-Befürwortern bereits seit ein paar Jahren auf den Tisch gebracht werden, klingen erst einmal vernünftig und schlüssig – und nach einer Win-Win-Situation für alle Seiten: Die Betreiber verdienen dran, klar. Die umliegenden Unternehmen könnten im Gegenzug von grünem Strom, Wasserstoff und Wärme zum Heizen profitieren, Haushalte ebenso, heißt es. Die Stadt Bad Harzburg bekäme neben Gewerbesteuereinnahmen auch eine sogenannte Akzeptanzabgabe von den Betreibern (siehe Kasten). Zudem begeistere das Projekt auch junge Menschen, die etwas verändern und bewirken wollen, berichtet Oliver Hennig, kaufmännischer Leiter der Goslarer Firma Fest, die den grünen Wasserstoff im Energiepark produzieren möchte. Weil sich das Unternehmen mit dem Thema beschäftigt, habe man bereits den einen oder anderen jungen Menschen für sich gewinnen können, der sich gezielt dazu entschieden habe, herzuziehen.
„Das ist ein schlechtes Zeichen“
„Der Bad Harzburger Stadtrat steht mehrheitlich hinter dem Energiepark“, unterstrich der Vorsitzende der Ratsgruppe SPD/FDP/Wählergemeinschaft, Michael Riesen, jüngst bei einem Treffen der Energiepark-Initiatoren bei der Firma H.C. Starck Tungsten in Oker. Auf der anderen Seite stehe Bad Harzburgs Bürgermeister Ralf Abrahms. Bei ihm herrsche ein „Kirchturmdenken“, ihn interessiere nicht, was außerhalb der Stadtgrenzen Bad Harzburgs passiere, so Riesen. An der Akzeptanzabgabe störe ihn, dass diese für soziale Zwecke eingesetzt werden darf. Auch das Argument der Gewerbesteuereinnahmen interessiere ihn nicht, weil diese erst nach Ende seiner Amtszeit, also nach 2026, fließen würden. Für die Grünen-Ratsdamen und Ratsvorsitzende Gabriele Alberts-Goebel eine nicht nachzuvollziehende Einstellung: „Ich verstehe einfach nicht, dass man nicht verstehen will, wie gut dieses Projekt ist“, sagte sie.
Man könne natürlich auch „Nein“ zu einem solchen Projekt sagen, merkte Alexander Heidebroek, geschäftsführender Gesellschafter der Firma Landwind, an. Doch aktuell wüssten die Initiatoren überhaupt nicht, woran sie seien. „Wenn gar nichts passiert, dann ist das ein schlechtes Zeichen für die Bevölkerung“, sagte er.
Unterlagen „mangelhaft“
Doch warum passiert denn nun nichts, wo doch der Rat die Verwaltung wie gesagt bereits damit beauftragt hat, mit dem Planungsverfahren zu beginnen? Die aktuelle personelle Lage gebe es einfach nicht her, begründet Bürgermeister Ralf Abrahms auf GZ-Nachfrage. Man habe derzeit schlichtweg „keine Leute“, die „Kapazitäten sind nicht da“. Es würden noch andere Verfahren laufen, die erst einmal bearbeitet werden müssten.
In den Reihen der Harlingeröder Landwirte ist man deshalb mittlerweile stinksauer. Andere Projekte würden vorangehen, etwa das Genehmigungsverfahren für ein Windrad der Industriepark- und Verwertungszentrum Harz GmbH auf dem ehemaligen Hüttengelände (die GZ berichtete), in Sachen Energiepark bewege sich aber seit mehr als einem Jahr nichts, heißt es von ihrer Seite. „Wir wollen Gleichbehandlung“, bekräftigt auch Michael Riesen. „Aber in Bad Harzburg werden einige Bürger offenbar weniger gemocht als andere.“ Der öffentliche Druck auf den Bürgermeister müsse deshalb größer werden, forderte Riesen.
Zwischendurch hatte man dem Bürgermeister gar damit gedroht, die Kommunalaufsicht einzuschalten. Die wiederum bescheinigte Abrahms allerdings, dass sein Vorgehen rechtens gewesen sei. Nicht allein die Personalsituation ist laut Bad Harzburgs Stadtoberhaupt der Grund für die Verzögerung: Zudem seien die eingereichten Planunterlagen der Energiepark-Initiatoren mangelhaft. Schon mehrfach seien Verfahrensfehler gemacht worden. Und diese Fehler wolle sich der Bürgermeister nicht zu eigen machen, betont er.
Was bringt die Akzeptanzabgabe wirklich?
Mehrere Gründe also, weshalb das Thema Energiepark mit Blick auf die gestrige Sitzung des Stadtplanungsausschusses bewusst erneut nicht auf die Tagesordnung genommen wurde. Abgesehen davon hält Abrahms auch seine eigene Meinung zum Projekt öffentlich nicht hinter dem Berg: Der Energiepark habe mit dem Thema Stadtentwicklung nichts zu tun, sagt er. Dabei gehe es nur um private Profitgier. Und auch das Argument der finanziellen Beteiligung der Stadt durch eine Akzeptanzabgabe klinge vielleicht ganz toll, nur komme es darauf an, worauf diese gezahlt werde. Laut Niedersächsischem Bürgerbeteiligungsgesetz, das im April 2024 in Kraft getreten ist, müssen Anlagenbetreiber die Abgabe nämlich nicht auf den erzeugten, sondern nur auf den tatsächlich ins Netz eingespeisten Strom zahlen. Das macht in Sachen Energiepark einen deutlichen Unterschied, denn in erster Linie soll der dort erzeugte Strom bekanntlich für die Wasserstoff-Produktion verwendet werden. In Zeiten besonders hoher Erzeugung werde zudem eine Batterie gespeist. Und erst wenn dann noch Strom übrig ist, wird er ins Netz abgegeben. Landwind-Chef Heidebroek kündigte aber bei dem jüngsten Treffen an, dass man auch auf den erzeugten Strom eine Abgabe zahlen wolle.
Auch Ratsherr Stefan Schlue (Freie Wähler) ist von der Abgabe beziehungsweise deren Höhe nicht vollends überzeugt. Die etwa 300.000 Euro, die da jährlich für Bad Harzburg heraussprängen, seien, gemessen am städtischen Haushaltsvolumen, „Peanuts“, sagte er. Womöglich müssten die Energiepark-Betreiber da noch etwas drauflegen, um den Bürgermeister „aufzuweichen“. Doch „ist die Stadt in der Lage, auf das Geld zu verzichten?“ entgegnete Landwind-Chef Heidebroek mit Blick auf die klammen Kassen und die düstere finanzielle Prognose für die Kommunen.AKZEPTANZABGABE
Neben der Gewerbesteuer, die von den Energiepark-Betreibern komplett an die Kurstadt gezahlt werden müsste, kämen für Bad Harzburg und Goslar auch Einnahmen durch die sogenannte Akzeptanzabgabe hinzu. Die gesetzlich festgeschriebene Summe von 0,2 Cent pro Kilowattstunde würde zu 60 Prozent an Bad Harzburg und zu 40 Prozent an Goslar fließen, weil sich der Energiepark auf beide Hoheitsgebiete erstreckt. Laut der Firma Landwind wären das, gemessen an der voraussichtlichen Stromerzeugungsmenge, 5,4 Millionen Euro in 20 Jahren. Zusätzlich dazu müssen die Betreiber den beiden Städten laut Gesetz ein angemessenes Angebot zur weiteren finanziellen Beteiligung unterbreiten, das einem Überschuss von mindestens 0,1 Cent pro Kilowattstunde entspricht. Das wären mindestens weitere 2,7 Millionen Euro in 20 Jahren.
Die Gemeinden müssen dieses Geld für etwas verwenden, das über ihre Pflichtaufgaben hinausgeht. Heißt beispielsweise, zur Steigerung und Erhaltung der Akzeptanz erneuerbarer Energieanlagen, aber auch für den Naturschutz, soziale und kulturelle Projekte, Bildung oder die Verbesserung der öffentlichen Daseinsvorsorge, schreibt das Land Niedersachsen.
Copyright © 2025 Goslarsche Zeitung | Weiterverwendung und -verbreitung nur mit Genehmigung.