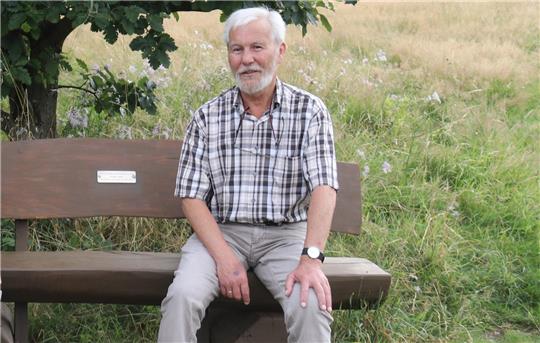Forscher wollen am Goslarer Bollrich seltene Metalle recyceln
Forscher wollen am Goslarer Bollrich seltene Metalle recyceln

Satellitenbild von den Teichen am Bollrich: links das braune Absitzbecken für Grubenwasser aus dem Rammelsberg, rechts der Blick auf Oker. Foto: Google
Deutschland ist abhängig von kritischen Rohstoffen. Die lassen sich auf alten Bergbauflächen recyceln – etwa aus dem Schlamm der Teiche am Rammelsberg in Goslar.
Clausthal/Goslar. „Es geht weiter am Bollrich“, meldet die TU Clausthal. Ein drittes Forschungsprojekt soll die technischen Fragen klären, um aus Millionen Tonnen Bergbauschlamm oberhalb von Oker künftig viele Wertstoffe zu recyceln: Kobalt und Indium, Gold und Silber, Kupfer und Pyrit – das klingt nicht nur in den Ohren von Geologen wie eine Melodie. Aber es geht auch um vermeintlich schnöde Massen an Schwerspat und Schiefermehl.
Der Kampf um kritische Rohstoffe ist weltweit in vollem Gange. Die frühere Ampel-Regierung hatte daher einen Rohstofffonds aufgelegt: eine Milliarde Euro, verteilt über die Jahre 2024 bis 2028, um Investitionen, Verarbeitung und Recycling wichtiger Rohstoffe zu fördern.
Der Kampf um Rohstoffe
Angesichts von einer Billion Dollar für solche Anstrengungen in den USA, Hunderten Millionen in Japan, aber auch hohen Investitionen in Frankreich und Großbritannien ist die Euro-Milliarde in Deutschland nur ein Tropfen auf den heißen Stein, macht Professor Daniel Goldmann klar, Experte für Recycling von Rohstoffen an der TU Clausthal. Doch selbst von der Milliarde aus Berlin sei bis Herbst 2025 „nach meiner Kenntnis noch nichts geflossen“, fügt Goldmann an – weil durch Ampel-Aus und Regierungswechsel lange ein gültiger Haushaltsplan fehlte. Und das, „obwohl wir tief in der Tinte sitzen“, unterstreicht Goldmann mit Blick auf Abhängigkeit von kritischen Rohstoffen in Deutschland. Schließlich geht es nicht nur um Rückhalt für Indus-trieproduktion, sondern angesichts der Weltlage auch um politische und soziale Sicherheit. Einen Mosaikstein könnte das Recycling von Material aus dem Bergbauschlamm des Rammelsbergs beitragen.
Handelskonflikt
Starker Preisanstieg bei seltenen Erden im dritten Quartal
„Retail“ heißt das Forschungsprojekt, für das laut Goldmann insgesamt rund 1,6 Millionen Euro zur Verfügung stehen – finanziert aus staatlichem Geld und Mitteln beteiligter Unternehmen. Das Ganze läuft im Rahmen der Förderlinie „Urban Mining“ des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt.
Die Teichkaskade am Rammelsberg mutet dabei für Spaziergänger im goldenen Herbstlicht fast romantisch an. Wie Knetmasse schlummern aber unter der zarten Wasseroberfläche rund sieben Millionen Tonnen Schlamm. Sie stammen aus der Erzverarbeitung zwischen 1937 und 1988, und bis heute fließt ein gelber Strom aus Grubenwasser in die Teiche oberhalb von Oker.
Kobalt, Indium, Schwerspat und Schiefermehl
Zink, Blei, Cadmium, Arsen und vieles mehr stecken in der giftigen Masse, die aber eine Menge wertvoller Rohstoffe birgt – wenn sie sich denn wirtschaftlich wiedergewinnen lassen. Goldmann arbeitet seit mehr als zehn Jahren daran.
„Rewita“ hieß das erste vom Bund geförderte Forschungsprojekt zum Bollrich, das 2015 für Aufsehen in ganz Deutschland sorgte – und darüber hinaus. Die Deutsche Presse-Agentur meldete damals versehentlich, es steckten 1,5 Millionen Tonnen Gold im Schlamm. Das brachte die Kurse an der Wall Street in New York aber nur kurzzeitig ins Wanken, denn alsbald folgte die Korrektur: Es sind nur 1,5 Tonnen Gold, dafür aber 1,5 Millionen Tonnen Schwerspat.
Als Mineral heißt dieser Stoff Baryt, chemisch Bariumsulfat, und das ist in deutschen Mittelgebirgen viel verbreitet. Industriell wird Schwerspat etwa für Strahlenschutzwände in Kliniken, aber auch für Schalldämmung, Kupplungsbeläge, Klebstoffe oder Poliermittel verwendet.

2015 untersuchten Forscher mit einem schwimmenden Bagger den Schlamm im Bergeteich am Bollrich. Foto: Epping
Seltener ist die Erde mit Kobalt versehen. Umso wertvoller ist das magnetische und spröde Metall für industrielle Anwendungen – ob früher für kobaltblaue Keramik oder heute für Smartphones oder E-Mobilität. 1200 bis 1300 Tonnen Kobalt sollen im Schlamm der Goslarer Bergeteiche stecken. Daher ist auch die Goslarer Firma H.C. Starck Tungsten mit im Projekt, die etwa an innovativen Verfahren zum Batterie-Recycling arbeitet.
Noch seltener als Kobalt ist das weiche Metall Indium, das oft bei der Verarbeitung von Zink- und Bleierzen anfällt, wie es am Rammelsberg typisch war. Verwendet wird Indium etwa für Touchscreens und Flachbildschirme. Im Schlamm der Bergeteiche sollen rund 100 Tonnen Indium gebunden sein.
Aber selbst für die mit Abstand größte Materialmasse in den Absitzbecken gibt es inzwischen einen potenziellen Abnehmer – für das bei der Erzaufbereitung zermahlene Schiefergestein. Es kann in der Zementindustrie verwendet werden, schildert Goldmann. Deshalb ist auch die Firma Holcim im schleswig-holsteinischen Lägerdorf, Teil des weltgrößten Zementherstellers, als Partner beim Forschungsprojekt mit an Bord, sagt Goldmann.
Treibstoff für die Salzgitter AG
Pyrit, auch als Katzengold oder Schwefelkies bekannt, steckt ebenfalls reichlich im Schlamm. Das pyrithaltige Material wiederum lässt sich durch ein Röstverfahren so aufspalten, dass am Ende Wasserstoffgas und Schwefelsäure für die Industrie produziert werden können, macht Goldmann deutlich: „Also eine gewaltige Wasserstoffproduktion.“ Deshalb sei auch die Salzgitter AG (Stahlindustrie) als Partner inzwischen mit im Boot.
Rewimet-Symposium in Clausthal
Minister Tonne: Rohstoffsicherheit braucht Einsatz aller
Die neuen Projekte laufen laut TU Clausthal im Verbund mit Industriepartnern des regionalen Recyclingclusters „Rewimet“ sowie weiteren Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Konkret geht es bei „Retail“ um Technik, Verfahren, Prozesse und Logistik für das Bollrich-Projekt. Wie lässt sich der Schlamm am besten aus den Teichen holen? Was ist für die Umgebung und den Damm zu beachten, der das Gelände Richtung Oker sichert? Wie und wo lässt sich der Schlamm entwässern? Wie lässt sich das Material dann verladen und transportieren?
Goslarer Firma Metalogie führt Regie

Tristan Niewisch Foto: Metalogie
Dazu gehört aber auch die Information der Öffentlichkeit über das Projekt. So ist beispielsweise für das Frühjahr 2026 eine öffentliche Veranstaltung in Oker geplant – ähnlich wie 2022 beim Vorgängerprojekt. Läuft die Erforschung wie erhofft, dann könnte es 2035 am Bollrich ans Eingemachte gehen, signalisiert Goldmann.
Rewimet-Symposium in Clausthal
Minister Tonne: Rohstoffsicherheit braucht Einsatz aller

Daniel Goldmann Foto: DMG
Copyright © 2025 Goslarsche Zeitung | Weiterverwendung und -verbreitung nur mit Genehmigung.