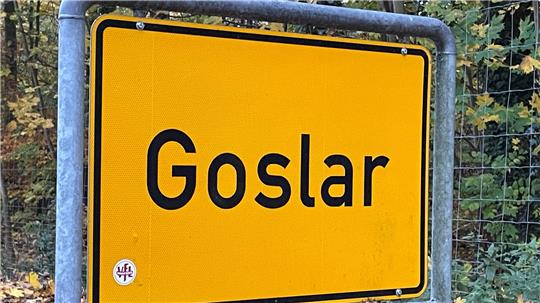Was passierte im Mittelalter auf der Pfalz Werla?
Was passierte im Mittelalter auf der Pfalz Werla?

Blick auf das herbstliche Werla-Gelände: Durch die Stahlkonstruktion, die ein Tor der Vorburg andeutet, fällt der Blick auf den Großen Fallstein, links das rekonstruierte Westtor. Wie es hier wohl vor mehr als 1000 Jahren zuging? Foto: Gereke
Die Werla ist vieles: Ein Ort der Geschichte und Archäologie, aber auch ein Platz zum Durchatmen - der Naherholung in Natur inmitten der Landschaft des nördlichen Harzvorlands. Eine Veranstaltung im Heimatmuseum Hornburg vereinte jetzt beide Seiten.
Hornburg. Großformatige Bilder von einem kleinen Paradies mit großer Artenvielfalt – das gibt es ab sofort im Hornburger Heimatmuseum zu sehen. Sie entstanden auf dem Sehnsuchtsort Werla – der Archäologie- und Landschaftspark auf dem Geländesporn über der Oker. Seit dem Jahr 2002 engagieren sich Frauen und Männer, um die alte Pfalz Werla wieder sichtbar werden zu lassen. Ziel: Den Menschen der Region die gemeinsame Geschichte vermitteln. In rund zwei Jahrzehnten hat Henning Meyer das sich entwickelnde Projekt fotografisch begleitet.
Die Fotografien spiegeln auch die Jahreszeiten im Archäologie- und Landschaftspark wider. Und Braunschweigs ehemaliger Bezirksarchäologe Dr. Michael Geschwinde, der das Projekt Werla seit Anfang des Jahrtausends bis zu seiner Pensionierung wissenschaftlich begleitet hatte, informierte mit launigen Worten, wie denn das Leben auf der Werla im Laufe der Jahreszeiten vor mehr als 1000 Jahren gewesen sein könnte. Er weiß: „Der Wechsel der Jahreszeiten ist auf der Werla ein eindrucksvoll.“ Im Mittelalter haben die Jahreszeiten ebenfalls der Orientierung gedient – die Zeitrechnung, in welchem Jahr man sich befand, hingegen spielte keine große Rolle. Sie erfolgte in Regierungsjahren des Herrschers. „Die Werla war eine von wenigen Orten, die durchstrukturiert waren, ausgerichtet auf die Königsaufenthalte“, sagte Geschwinde. Denn das Mittelalter war die Zeit des Reisekönigtums. Könige waren verdammt dazu, durch die Provinzen zu ziehen. Denn Herrschaft bedeutete damals Herrschaft über Menschen, nicht über Territorien, so der Archäologe. „Man spricht von konsensualen Herrschern. Sie hatten ihre Untertanen so zu motivieren, dass sie ihm folgten – beispielsweise durch Geschenke.“
Über die Werla nach Quedlinburg als des Königs Route
Wenn nun der König durchs Land reiste, dann in einem Hofstaat von bis zu 1000 Gefolgsleuten. Ein riesiges Aufgebot, das auch versorgt werden musste. „Ein Königsaufenthalt konnte die Leute arm machen – auch das war ein Grund, durchs Land zu ziehen.“ Zur Versorgung des Hofstaats standen der Werla große Ländereien zur Verfügung – aber wann kam der König, wie sahen seine Reisepläne aus, gab es einen Jahreszyklus? Dieser Frage widmete sich Geschwinde. Er notierte die verbürgten Aufenthalte von Heinrich I. über Otto den Großen bis hin zu Otto III. und Heinrich II. auf der Werla. Oft finden sich die Monate März und April. „Nachdem die Könige in der Pfalz Königsdahlum Weihnachten gefeiert hatten, zogen sie weiter und erreichten die Pfalz Werla, weil sie Ostern in Quedlinburg verbringen wollten“, so Geschwinde.

Braunschweigs ehemaliger Bezirksarchäologe Dr. Michael Geschwinde spricht zur Ausstellungseröffnung zum Thema „Vier Jahreszeite und zwölf Monate auf der Werla“. Foto: Gereke
Wenn ein Königsbesuch anstand, dann begannen die Vorbereitungen auf der Pfalz. „Räume und Kirche auf der Werla waren komplett leer. Es begann das Putzen, alles musste für den Königsaufenthalt fit gemacht werden“, so der Wissenschaftler. Dazu mussten große Mengen Schlachtvieh zur Pfalz getrieben werden – das Futter für sie musste genau kalkuliert werden. 1000 Mann bedeutete auch 1000 Pferde – auch die galt es zu versorgen. Das Brot backen und Bier brauen begann. „Räume wurden durch das Aufhängen von Teppichen hergestellt – so viel zur Privatsphäre.“ Wände gab es nämlich nicht. Über den Eselstieg musste das Wasser zur Werla transportiert werden. Häuser gab es natürlich nicht für alle des Hofstaats. Der Großteil wohnte in Zelten. „Das Mittelalter war die Hochzeit der Camper“, weiß Geschwinde. Und wer sozusagen ein festes Dach über dem Kopf hatte, hatte unter Umständen mit anderen Problemen zu kämpfen: „Wir entdeckten bei gefundenen Schädeln Rußablagerungen in den Gehörgängen. Es gab damals keine Rauchabzüge, der Qualm zog durch das Dach und Aschepartikel lagerten sich in den Mittelohrgängen ab. Das hatte das Potenzial für Mittelohrentzündungen – in einer Zeit, in der es kein Antibiotika gab“, so Geschwinde. Aber was geschah, wenn ein Ereignis plötzlich den Königsaufenthalt durchkreuzte und er nicht kam? „Meine Vermutung: Tiere und Nahrung sind zum Teil an andere Pfalzen weitergegeben worden.“
Rund sechs Wochen dauerte wohl der Spuk, „ansonsten ging es auf der Werla gemütlich zu.“ Laut Geschwinde dürfte es nicht sehr viele Menschen gegeben haben, die dauerhaft auf der Werla lebten. „Ich schätze, nicht mehr als 40.“ Aber die Pfalz profitierte von einem starken Abhängigkeitssystem. Bauern waren verpflichtet, Naturalien und Dienstleistungen zu erbringen. „Man konnte nach festgelegten Regeln auf die Bauern der Umgebung zurückgreifen.“ Aber die Maxime, erst die Ernte für den Herrenhof‘ konnte zu Problemen führen, wenn ein Wetterumschwung anstand, der die eigene Ernte gefährdete. Übrigens bestimmte der Wetterzyklus auch noch etwas anderes. Der ehemalige Bezirksarchäologe: „Der Winter war die klassische Jahreszeit für Überfälle – die Flüsse waren zugefroren, Reitergruppen konnten schnell übersetzen.“

Der Hornburger Fotograf Henning Meyer (r.) hielt über viele Jahre mit seinen Bildern die unterschiedlichen jahreszeitlichen Stimmungen auf der Werla fest. Foto: Gereke
Am Ende der Ausführungen schränkte Geschwinde allerdings ein: „Aber letztlich wissen wir ja nicht, wie es wirklich war. Ich kann ihnen nur ein paar Leitplanken mitgeben.“ Wirklich so waren aber die Momente, die Meyer mit seiner Kamera einfing. Und eine Auswahl an Bildern zu treffen, die jetzt zu sehen sind, so wie vor anderthalb Jahren auch in der Volksbank Schladen, war gar nicht so einfach. Frank Oesterhelweg, Vorsitzender des Werla-Fördervereins, schätzt, dass die Zahl der Werla-Bilder in Meyers Fundus mittlerweile fünfstellig sein muss. Zunächst fotografierte der 77-jährige Hornburger in seinen letzten Berufsjahren für die Grabungstechniker, um die Funde zu dokumentieren. „Unterwegs war ich oft mit einer Pflanzenschutzspitze – darin war Wasser und damit benässte ich Objekte, um den Kontrast zu verbessern.“ Maßstab und Nordpfeil auf den Aufnahmen waren ebenfalls wichtig für den Mann, der zuvor als Mediengestalter Schulbücher gestaltet hatte. „Mit Beginn meiner Arbeit auf der Werla hatte ich immer einen Kompass in der Tasche.“
Er erzählt von der Abfallgrube, die er fotografierte, in der später Keramik aus der Bronzezeit zum Vorschein kam. „Insgesamt 11,5 Kilogramm“, weiß er noch heute. Bei einer früheren Ausstellungseröffnung sprach er auch von der Frau auf der Werla – die Entdeckung eines 4500 Jahre alten Skeletts. „Wer war eigentlich Ötzi? Die Pfalz ist immer für eine Überraschung gut“, hatte er gesagt. Als die Grabungen begleitender Fotograf erhielt er auch den Beinamen „Der Mann, der keine Sonne mag“, hatte er mal im GZ-Gespräch erzählt. Ganz so ist es nicht. „Aber wenn es Grabungsfunde zu dokumentieren gab, dann sorgte Sonnenschein für Schlagschatten. Also mussten Grabungstechniker mit Sonnensegeln anrücken, um das zu verhindern.“
Die erste Kamera zur Konfirmation
Nach dem Ende seiner beruflichen Tätigkeit dort kehrte er aber immer wieder zurück. Das Werla-Feuer in ihm war entfacht. Denn ein neuer Tag mit anderen Lichtverhältnissen konnte auf einem Bild schon eine ganz andere Stimmung erzeugen, als es noch 24 Stunden zuvor möglich war. Qualität für ihn dabei oberstes Gebot: „Bei meinen Bildern gibt es keine Unschärfen – sie genügen höchsten Ansprüchen.“ Und die legt auch er an. Das Erleben der Grabungen mehrte auch sein Wissen. Als eines Tages auf der Werla eine Geburtstagsgesellschaft auf einen Staatssekretär-Besuch traf und Meyer mittendrin etwas von seinem Wissen teilte, bekam es Grabungsleiter Blaich mit. „Ab jetzt machst Du Führungen“, lautete sein Urteil. Und so berichtete Meyer auch am Rande der Ausstellungseröffnung von den Methoden, derer sich Archäologen bedienen, um dem Untergrund Geheimnisse zu entlocken.
Seine Leidenschaft fürs Fotografieren begann übrigens 1962. Damals kaufte er sich vom Konfirmationsgeld seine erste Kamera, um zu knipsen. Zu sehen sind seine Bilder noch bis zum 14. Dezember zu den Öffnungszeiten des Heimatmuseums. Enden wird die Ausstellung mit einer Finissage und einem weiteren Vortrag, verriet Susanne Kühne, Vorsitzende des Förderkreises Heimatmuseum Hornburg, schon jetzt. Auch für sie ist die Werla ein ganz besonderer Ort, auch, weil dort nicht Geschichte mit „erhobenem Zeigefinger“ vermittelt wird, sondern man dort einfach auch ganz gemütlich spazieren gehen kann.

Die Aufnahme zeigt, dass sich das Pfalzgelände auf einem Geländesporn befindet, der zur Oker abfällt. Foto: Gereke
Mitte Dezember will dann auch der Förderverein seine neue Broschüre vorlegen, in der es sich darum dreht, welche Tier und Pflanzenarten auf der Werla zu finden sind, informierte Oesterhelweg, der ebenfalls betonte, dass es auf der Werla nicht nur um Archäologie und Geschichte, sondern auch um Natur und Landschaft gehe. Der Landkreis Wolfenbüttel hatte zur Fauna und Flora eine Artenerhebung gemacht – deren Ergebnisse will er am 30. Oktober im Rahmen einer Vortragsveranstaltung präsentieren.
Den ehemaligen Bezirksarchäologen Geschwinde lobte Oesterhelweg übrigens als den Mann, der wirklich den Startschuss zum Projekt Werla gegeben hatte. Anfang des Jahrtausends hätte der nämlich in einer Gesprächsrunde verdeutlicht: „Wenn ihr jetzt nicht tätig werdet, dann wird alles, was noch im Boden ist, verloren sein“, zitierte der Werlaburgdorfer die Worte des Wissenschaftlers. Denn damals waren große Teile des heutigen Landschafts- und Archäologiepark-Areals noch in landwirtschaftlicher Nutzung – beispielsweise jedes Pflügen barg die Gefahr, dass archäologische Geheimnisse im Boden weiter leiden konnten. Aber es kam anders – und für die Werla begann eine neue Zeitrechnung. Ein Besucher sprach von einem „wohligen Gefühl“, das ihn bei einem Besuch des Pfalzgeländes immer überkomme. Für Geschwinde ein „großes Kompliment“, das zeige, dass „wir den Moment der Werla erhalten haben, den Balkon des Nordharzvorlandes.“
Copyright © 2025 Goslarsche Zeitung | Weiterverwendung und -verbreitung nur mit Genehmigung.