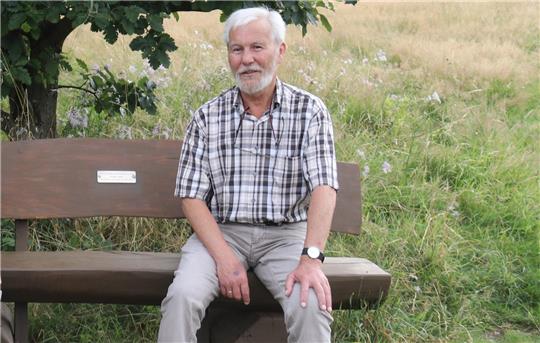Wie verändert das Jahrhundertprojekt die Landschaft am Bollrich?
Wie verändert das Jahrhundertprojekt die Landschaft am Bollrich?

Blick auf einen der Bergeteiche am Bollrich: Die Idylle ist trügerisch. Foto: Jörg Kleine
Professor Daniel Goldmann plant ein gigantisches Projekt, um seltene Metalle aus Bergbauschlamm zu holen. Es geht um Hunderte Millionen Euro.
Goslar/Clausthal. Die Schatzsuche am Bollrich geht weiter. Rund sieben Millionen Tonnen Bergbauschlamm schlummern in den Teichen oberhalb von Oker. Kobalt, Indium, Gold und Silber sollen möglichst daraus recycelt werden – und gigantische Mengen Gesteinsmaterial für die Zementindustrie. Es geht um Hunderte Millionen Euro – Kosten und Einnahmen. Doch wie und wann könnte das umgesetzt werden?
Wertstoffe aus dem giftigen Schlamm
Das neue Programm „Retail“ soll die technischen und logistischen Anforderungen dafür erforschen. Aus Fördermitteln des Bundes und Beteiligungen von Partnerfirmen stehen ab sofort insgesamt 1,6 Millionen Euro zur Verfügung (wir berichteten), um eine Perspektive zu entwerfen, wie sich der giftige Schlamm aus den Abraumteichen des Rammelsberges zu wertvollen Rohstoffen aufbereiten und vermarkten lässt.
Bagger mit Rüssel saugen im Schlamm

Professor Daniel Goldmann Foto: DMG
Gleich in der Nähe mächtige Apparaturen, die die feinkörnige Masse physikalisch und chemisch aufbereiten. Güterzüge mit Waggons voller Schiefermehl, die von Oker aus über die Schiene nach Schleswig-Holstein gefahren werden. Metallhaltiges Gestein wird wiederum zur Salzgitter AG transportiert, um es in einem speziellen Röstverfahren aufzubereiten.
Sanftes Kerbtal mit Stausee und Kraftwerk?
Am Ende ist die ganze Teichkaskade am Bollrich abgeräumt, die Gelmke plätschert als Bach wie ehedem durch ihr Kerbtal. Ein neues Rückhaltebecken puffert Starkregen gegen Hochwasser. Und ein Pumpspeicherkraftwerk stabilisiert dereinst vielleicht mit grünem Strom das Energienetz in Oker und Goslar. Das alles hat Goldmann auf dem Schirm bei seiner Zukunftsvision für das Recycling-Projekt am Bollrich.
Kreislaufwirtschaft im Harz
 TU Clausthal kümmert sich um Sicherung von Rohstoffen für Europa
TU Clausthal kümmert sich um Sicherung von Rohstoffen für Europa
Aktuell zeigt die Lage am Bollrich, ein paar Steinwürfe vom Goslarer Flugplatz entfernt, vier Teiche – die nach unten immer größer werden. Ein Damm stützt das Gelände, damit die ganze Masse nicht nach unten Richtung Oker strömt.
Die Masse stammt aus der Erzaufbereitung der früheren Preussag am Rammelsberg zwischen 1937 und 1988. Die Wasserdecke in den Teichen ist nur 20 Zentimeter bis drei, vier Meter tief. Darunter liegen die bis zu 25 Meter mächtigen Schlammschichten.
Ein brauner Strom mit Grubenwasser

Im ewigen gelbbraunen Bach rauscht Grubenwasser in die Bergeteiche. Foto: Jörg Kleine
Es rauscht aus der Ferne idyllisch, erzeugt beim näheren Anblick allerdings eher Ekel: Ein gelbbrauner Strom ergießt sich unentwegt. Hände weg und Füße weg, das ist ganz sicher nicht zum Spielen. Erst weiter unterhalb zum ersten Teich hin soll ein völlig verwittertes und unleserliches Schild manch neugierigen Spaziergänger auf Gefahren hinweisen.
Die ganze Szenerie, das gesamte Gelände dort könnte sich in Zukunft aber ändern, wenn die Wertstoffe aus dem Schlamm recycelt werden. Denn Rohstoffe sind weltweit knapp und begehrt, allemal Metalle wie Kobalt, Indium, Gold und Silber. Aber auch Kupfer, Blei und Zink sind im Schlamm enthalten.
Wie sicher ist der Damm oberhalb von Oker?
Zudem treibt Experten die Frage um, ob der Damm an den Bergeteichen für immer standhaft bleibt. Denn niemand mag sich vorstellen, dass die ganze Suppe irgendwann einmal Richtung Oker durchbricht.
„Wenn wir klimatische Bedingungen haben wie früher, dann mache ich mir wenig Sorgen“, sagt Professor Goldmann. Die Entwicklung in den vergangenen Jahren mit langen Trockenphasen könnten indes zu Rissen im Damm führen. Folgende Unwetter könnten dann für Gefahren sorgen. Deshalb gehöre eine „geotechnische Betrachtung“ ebenso zum Projekt am Bollrich.Kobalt, Indium, Gold und Silber
 Forscher wollen am Goslarer Bollrich seltene Metalle recyceln
Forscher wollen am Goslarer Bollrich seltene Metalle recyceln
In die Öffentlichkeit kamen die Recycling-Pläne 2015 mit dem Programm „Rewita“ zur Erkundung, was genau an Wertstoffen im Schlamm der Teiche steckt. Dann folgte bis Anfang 2024 das Programm „Reminta“ zur Erforschung, wie sich die Wertstoffe aus sieben Millionen Tonnen „Knetmasse“ befreien lassen.
3,5 Millionen Tonnen für die Zementindustrie
Nach „Rewita“ und „Reminta“ ist mit „Retail“ nun die dritte Stufe gezündet. Im Rahmen der Förderlinie „Urban Mining“ des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt sei im November gleich eine Reihe von Forschungsprojekten gestartet, „darunter allein drei am Institute of Geotechnology and Mineral Resources (IGMR) der TU Clausthal“, heißt es in einer Meldung. Die neuen Projekte laufen dabei in Kooperation mit Industriepartnern des regionalen Recyclingclusters „Rewimet“ sowie verbundenen Unternehmen und Forschungseinrichtungen.
Szene am Bollrich aus dem Jahr 2015: Mit einem Bagger auf einem schwimmenden Ponto holen Forscher Proben aus dem Schlamm des Bergeteichs. Foto: TU Clausthal
Transport mit Zügen nach Schleswig-Holstein
Doch was genau lässt sich aus den bisherigen Projekten und Erkenntnissen zum Bollrich ableiten? Goldmann macht folgende Rechnungen auf:
- Aus dem Schlamm der Bergeteiche geht es im Wesentlichen um drei Fraktionen – schwefelhaltiges Material, Schwerspat und mineralisches Material für die Zementindustrie.
- Insgesamt bis zu 3,5 Millionen Tonnen Material könnten über die Jahre zur Zementfabrik der Firma Holcim nach Lägerdorf in Schleswig-Holstein gehen.
- Bis zu 700.000 Tonnen Material pro Jahr würden dabei am Bollrich umgeschlagen.
- Der Transport könnte über die Schiene in Oker erfolgen.
- Parallel zum Ausbaggern des Schlamms müsste auch der Damm schrittweise „weggehobelt“ werden, damit er nicht in den Teich kippt.
Ein Projekt für die nächsten 30 Jahre
Weitere Erkenntnis soll nun das Programm „Retail“ bringen. Die Koordination des ganzen Projekts obliegt dabei der Goslarer Spezialfirma Metalogie, die Begleitforschung wird von der TU Clausthal dirigiert.Rewimet-Symposium in Clausthal
Minister Tonne: Rohstoffsicherheit braucht Einsatz aller
Am liebsten hätte Goldmann am Bollrich eine Großanlage aufbauen lassen. Daraus macht er keinen Hehl. Mit rund 20 Millionen Euro „ließe sich schon was anstellen“, erklärt der Professor von der TU Clausthal. Da nehmen sich die mit „Retail“ tatsächlich zur Verfügung stehenden 1,6 Millionen Euro wahrlich sehr bescheiden aus.
Für dieses Projekt laufen nunmehr die Ausschreibungen, und das Konzept soll im Frühjahr 2026 in Oker öffentlich präsentiert werden. „Wir wollen die Bevölkerung mitnehmen“, betont Goldmann.
Wann es denn im großen Stil wirklich losgehen könnte? „Ich hatte immer die heimliche Hoffnung, dass wir 2030 mit einer Produktionsanlage beginnen können“, sagt Goldmann. Doch Corona-Pandemie und knappe Kassen brachten weitere Verzögerung, erklärt der TU-Professor: „Wenn wir jetzt 2035 beginnen können, bin ich schon froh.“
Danach liefe das Recycling-Projekt am Bollrich nach Goldmanns Einschätzung rund zehn Jahre. Bis dann schließlich auch ein Stausee und ein Wasserkraftwerk entstehen könnten, „wären wir am Ende der 50er Jahre“ – 2050er wohlgemerkt.
Copyright © 2025 Goslarsche Zeitung | Weiterverwendung und -verbreitung nur mit Genehmigung.