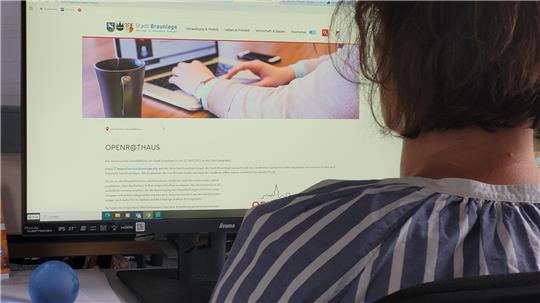Wenn Pflanzenschutzmittel und Bodenbearbeitung tabu sind
Wenn Pflanzenschutzmittel und Bodenbearbeitung tabu sind

Henrick Dieckmann ist Landwirt in vierter Generation. Foto: Leifeld
Es ist kein Wildwuchs, sondern ein Förderprogramm. Was ist los in der Langelsheimer Feldmark?
Langelsheim. Nanu, was ist da denn los? Hüfthoch stehen die Disteln mit Klatschmohn und weiteren Wildkräutern im Feld. Der Sommerweizen, mit nur kurzen und dünnen Ähren, ist kaum noch zu erkennen.
Wo noch vor wenigen Jahrzehnten mancher Spaziergänger abfällig gesagt hätte: „Da hat ein Landwirt sein Feld nicht im Griff“, liegen in der Gegenwart die Dinge anders. Dort, hoch oben am Flurstück „Holzkamp“, nördlich der Ortschaft Langelsheim und vis-à-vis der sogenannten Kaninchenwiese, handelt es sich bei dem naturnahen Wildwuchs um ein Agrarumweltprojekt aus dem AN4-Programm. Dies regelt eine naturschutzgerechte Bewirtschaftung zum Schutz von Ackerwildkräutern.

Die Entwicklung und Vermehrung der Wildkräuter wird in dem Förderprogramm erfasst. Foto: Leifeld
Eigentümer der zwei Hektar großen Fläche ist Landwirt Henrick Dieckmann. Der 59-jährige Langelsheimer ist in vierter Generation Landwirt und bewirtschaftet 140 Hektar. Der Argwohn, den manche Spaziergänger dieser so schlimm verkrauteten Fläche entgegenbringen, ist ihm durchaus geläufig. Noch die Generation seines Vaters hätte die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weiß er. Aber der Zeitgeist habe sich nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in den Agrarberufen geändert.
„Artenschutz ist nicht möglich, ohne eine entsprechende Datenbasis“, verdeutlicht Dieckmann. Für einen zielgerichteten und effizienten Naturschutz werden Angaben über Vorkommen und Bestandsentwicklung der Tier- und Pflanzenarten benötigt.
AUKM-Förderprogramm
Dafür gebe es beim Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) im Rahmen des Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)-Förderprogramms verschiedene Maßnahmen zur Meldung wildlebender Tiere und von Wildkräutern. Und das in seinem Fall angewandte AN4-Förderprogramm sei eben auf die Kartierung heimischen Wildkräuter ausgerichtet, schildert der 59-jährige Landwirt.
Die darin erfassten Daten liefern die Basis für die Artenerfassung. Dies bildet die Grundlage, um Aussagen zu Vorkommen, Verbreitung und Gefährdung in Niedersachsen zu treffen. Nicht nur Dieckmann, sondern auch zwei weitere Landwirte mit Flächen in der Gemarkung Langelsheim sind in das Projekt involviert.
Und wie gestaltet sich die Teilnahme am AN 4-Förderprogramm für den heimischen Landwirt? Das Saatgut des Sommerweizens musste bis zu einem vorab festgelegten Stichtag, in diesem Fall war es der 15. April, gedrillt (ausgesät) sein. „Danach darf ich das Feld nicht mehr bearbeiten. Alles wächst, blüht und bleibt, wie es mag“, erklärt er. Pflanzenschutzmittel, wie Pestizide gegen Krankheiten, Insektizide gegen Schädlinge oder auch Herbizide zum Spritzen gegen Wildkräuter, sind absolut tabu. Auch ein mechanisches Vorgehen gegen Wildkräuter, beispielsweise mit einem Striegel, ist nicht gestattet. Ebenso sind Düngen oder zusätzliche Befahrung des Felds bis zur Erntezeit untersagt. „Der landwirtschaftliche Boden ist auf diesem Feld ohnehin minderwertig. Er enthält wenig Humus und viel Kalkstein. Das macht ihn aber für viele besondere Wildkräuter interessant“, erklärt der Landwirt.
Gesellschaftspolitisch gewollt
Die Ernte des Getreides wäre ihm im Herbst gestattet, aber Dieckmann verzichtet freiwillig. „Der Landhandel würde so ein durch Wildkräutersamen verunreinigtes und dazu minderwertiges Getreide vermutlich gar nicht annehmen. Die Mühlen könnten die Verunreinigungen gar nicht aussieben“, erklärt er die Nachteile. So wird er den Weizen nur häckseln. Eine mechanische Bodenbearbeitung wäre ihm auf diesem Versuchsfeld erst ab Mitte September wieder gestattet. Und dann heißt es erneut „Nichtstun“ bis zur Aussaat im kommenden Frühjahr.
Das gesamte AN4-Programm ist auf eine Laufzeit von fünf Jahren ausgelegt. Nach drei Jahren muss Henrick Dieckmann eine andere Feldfrucht anbauen. Gestattet sei ihm so im kommenden Frühjahr beispielsweise der Anbau von Raps oder Hafer.

Der Sommerweizen ist kaum zu erkennen. Foto: Leifeld
Aber das Augenmerk von Fachleuten und Umweltschutz liegt auf den Erkenntnissen, wie sich dieses Nichtstun auf die Entwicklung der Wildkräuter auswirkt. Regelmäßig werden diese Flächen durch Mitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Goslar betreut und begutachtet und Vorkommen dokumentiert. Die Zusammenarbeit sei eng. Mit der Dokumentation der entdeckten Wildkräuter hat Henrick Dieckmann selber nichts zu tun. Aber auch er beobachtet diese zwei Hektar. „Niedrigwild, wie beispielsweise Feldhasen, findet hier eine gute Deckung. Das ist schön anzusehen.“
Artenvielfalt ist Lebensqualität
Die viele Arbeit, die auf ihn wartet, um das Feld nach dem Abschluss des fünfjährigen Versuchsprogramms wieder für die konventionelle Landwirtschaft nutzen zu können, möchte er an dieser Stelle nicht beschreiben oder bewerten. „Es ist gesellschaftspolitisch so gewollt“, hält er fest. Und Artenvielfalt sei schließlich Lebensqualität.
Copyright © 2025 Goslarsche Zeitung | Weiterverwendung und -verbreitung nur mit Genehmigung.